Teil VI – Die Sehnsucht nach Geborgenheit (4)
Burg Rabenmund – 22. Peraine, 34 nach Hal – Tief in der Nacht
Für den Wüstensohn verstrich die Zeit in den Gemäuern von Burg Rabenmund quälend langsam. Er war hellwach, seine Sinne geschärft und sein Bein schmerzte nicht mehr. Er kostete jeden Moment aus, denn er wusste, dass der kleinste Fehler das Ende von ihm und den Galottanern bedeuten würde. Die verbliebenden Rabenmunder Gardisten würden nicht lange fackeln und kurzen Prozess mit ihnen machen. Ihr Trupp war inzwischen komplett bewaffnet, doch das sollte eher für ihre weitere Flucht außerhalb der Festung dienlich sein als hier. Sicherlich, eine Waffe in den Händen zu halten wäre im Moment einer Entdeckung hilfreich, doch sie alle waren in einer miserablen körperlichen Verfassung und in einem desolaten moralischen Zustand. Im Moment überwog zwar die Hoffnung auf eine erfolgreiche Flucht, doch diese Hoffnung stand – und das wusste Kalkarib – auf Messers Schneide.
Halbhand führte die gemischte Gruppe durch die Mauern des Stammsitzes der mittelländischen Familie. Sie gingen eine Wendeltreppe hinab und waren wieder in einem unterirdischen Gang angekommen, als er plötzlich vor einem großen Wandschrank stehen blieb. „Hier, hier ist es.“ Er zuckte wieder mit dem Augenlid und tapste zaghaft auf das Holz, als wäre es etwas Besonderes, dass man leicht kaputt machen könnte. „Was soll hier sein?“, warf Kalkarib im Flüsterton ein, denn er konnte beim besten Willen nur kalten Stein und einen hölzernen Schrank sehen. „Dahinter ist der Geheimgang nach draußen“, antwortete Halbhand und kaum hatte er es ausgesprochen, machten sich mehrere der Tobrier auch schon daran, ihn anzuheben und vorsichtig zur Seite zu hieven. Kalkarib blinzelte verwirrt und musste erst seine Gedanken sammeln. Hatte Halbhand ihn hinters Licht geführt? Zwar wurde auch in ihm die Freude auf eine gelungene Flucht größer, aber entgegen seiner Anweisung, hatte Halbhand sie nicht zu Belzora, sondern zum Fluchttunnel geführt. „Halt! Wartet, wir müssen noch Belzora retten.“ Doch die Männer machten keine Anstalten mit ihrem Vorhaben aufzuhören, stattdessen wandte sich Karmold an ihn: „Sprich für dich, Novadi – sie ist schon längst tot“, sagte er im ernsten und düsteren Ton, ehe er weitersprach: „Wir sollten machen, dass wir hier rauskommen.“ Karmolds Worte trafen Kalkarib wie Dolche direkt ins Herz. Wie konnte er das nur sagen? Er konnte es nicht wissen. Außerdem war ER der Anführer dieser Gruppe, und nicht Karmold. „Wir müssen sie retten!“, fauchte Kalkarib, packte Karmold an der Schulter und riss ihn herum, er spürte, wie die Wut wieder in ihn hochkochte. Der alte Mann entgegnete ruhig und entschlossen: „Was willst du machen, Novadi? Mich töten? Bei der Herrin der Untoten, wir sind ohnehin schon alle längst tot – sie hier auf der Burg zu suchen käme dem gleich. Ich für meinen Teil, versuche mein Glück lieber da draußen.“ Und mit diesen Worten riss er seine Schulter unsanft aus Kalkaribs Griff und schaute ihm abwartend an. Unterdessen hatte die Tobrier den Schrank zur Seite gehoben und tatsächlich kam dahinter ein schmaler, mit Spinnweben behangener Gang zum Vorschein. Der Wüstensohn blickte von Karmold in die Gesichter der anderen, nacheinander suchte er sie vergeblich nach Unterstützung ab. In ihren bis auf die Wangenknochen ausgemergelten und schmutzigen Gesichtern lag die pure Angst, kein Feuer loderte in ihnen. Wahrscheinlich wären Sie Kalkarib gefolgt, doch nun, wo sie direkt vor dem Ausgang in die Freiheit standen, war die Aussicht auf diese größer, als die frisch entfachte Treue zu einem unbekannten Novadi. Kalkarib wurde in diesem Augenblick schmerzlich bewusst, dass nicht nur Halbhand ihn an der Nase herumgeführt hatte, sondern er auch beim besten Willen keine Worte hätte finden können, die diese Männer und Frauen jetzt dazu zu bewegen würden, sich erneut in Todesgefahr führ ihn oder Belzora zu begeben. Die Wut ihn ihm wich tiefgehenden Mitgefühls, welches er für die Tobrier empfand. „Dann geht“, sagte er kurz angebunden und atmete dabei schwer aus, denn er musste jetzt eine schicksalsvolle Entscheidung fällen. „Ich werde niemanden aufhalten, doch ich suche Belzora und rette sie. Vielleicht sehen wir uns draußen, mögen eure Götter mit euch sein.“ Er machte auf dem Absatz kehrt und kein Widerspruch erklang. Seine Gedanken waren bei seiner Beschützerin aus der Zelle, die ihm das Leben gerettet hatte. Ohne sie hätte er die ersten Tage hier im Kerker nicht überlebt. Seine Ehre gebot ihm, das Selbe nun für sie zu tun, ganz gleich wer sie war oder was sie zuvor getan oder nicht getan hatte. Sie hatte es verdient, dass er es wenigstens versuchen würde, sie zu finden und zu retten. „Los kommt, gehen wir“, hörte er noch Karmold hinter sich sagen, da packte ihn plötzlich jemand an der Schulter und Kalkarib fuhr angespannt herum. Vor ihm standen Yaqi und zu seiner Verwunderung auch der schüchterne Scharlatan Radromir. „Warte, ich helfe dir“, sagte Yaqi und ihre Worte waren wie Balsam für Kalkaribs Gemüt. Radromir, der mit seiner restlichen Sensibilität für soziale Interaktion bemerkte, dass auch er etwas aufbauendes sagen sollte, entschied sich mit unsicherer Stimme für: „Ich kann euch doch nicht allein gehen lassen, ohne mich wäret ihr doch aufgeschmissen.“ Yaqi und Kalkarib belegten den Scharlatan mit einem fragenden Blick und als dieser spürte, wie sich diese wie Dolche in ihn hineinbohrten, schob er erklärend hinterher: „Na, wegen der Schlösser! Keiner von euch kann … Schlösser öffnen, ja?“ Da Radromirs Nervosität von Moment zu Moment immer stärker wurde, entschied sich Kalkarib für ein entschärfendes Lächeln und sagte: „Danke, dass du mitkommst, Radromir. Ich weiß das zu schätzen.“ Erst jetzt wich langsam die Unsicherheit aus Radromir und während er mit dem Finger verlegen in seinen langen Locken spielte, überkam auch ihn ein kleines Schmunzeln. Während Karmold den Großteil der Galottaner durch den Fluchttunnel führte, schlossen sich Kalkarib, Yaqi und Radromir zusammen, um Belzora zu befreien.
Die Suche nach ihr gestaltete sich jedoch nicht einfach, denn keiner von ihnen wusste, wo sie sie hingebracht hatten. Sie wussten, dass vom tiefsten Kerker, über hängende Käfige auf dem Burghof, bis hin zur höchsten Zinne alles möglich war. Zudem kam erschwerend hinzu, dass sie sich die ganze Zeit vorsichtig und langsam fortbewegen mussten, um nicht entdeckt zu werden und es zu allem Überfluss auch noch tiefste Nacht war. Letzteres kam ihrer Heimlichkeit auch zugute, immerhin schlief auch ein Großteil der verbliebenden Burgbesatzung, aber das gleiche konnte auch für Belzora gelten. Fast schon wünschte sich Kalkarib, dass sie gerade gefoltert werden würde, dann würde man zumindest wissen, dass sie noch am Leben war und wo sie sich aufhielt. Nach einer Weile des vorsichtigen Suchens war es Radromir, der eine entscheidende Eingebung hatte: „Wie wäre es, wenn wir jemanden fragen?“ Auch wenn die Frage anfangs äußerst dümmlich erschien, so war sie doch simpel und zugleich zutreffend, dachte Kalkarib. „Hmm, aber wen? Schlafen diese Wachen nicht alle zusammen in einem Raum?“ Die zwei Wachen vor der Waffenkammer konnten sie nicht mehr fragen, die Galottaner hatten ihre Lebenslichter bereits ausgeblasen, nachdem sie zuerst nur betäubt waren. Kalkarib hätte es gerne verhindert, doch dann wäre seine Tarnung wohl oder übel aufgeflogen. „Was ist mit der Kerkerwache?“, warf Yaqi ein. Sie hatten die Kerkertür wieder geschlossen, als sie alle entkommen waren, damit es der Wache nicht auffallen würde. Erst jetzt fiel Kalkarib ein, dass Yaqi einen der Wachschemel hatte mitgehen lassen und das dessen Verschwinden anscheinend – zu ihrem Glück – nicht zu viel Misstrauen bei der Wache hervorgerufen hatte. „Der sollte allein da unten sein, und noch dazu müde. Er wäre ein leichtes Opfer und sollte wissen, wo das Rabenmund-Kind die Gefangenen hinbringt“, sagte Kalkarib und bekräftigte damit Yaqis Plan. Vorsichtig schlichen sie daher zurück in den Kerker der Burg. Unterwegs mussten sie einer Patrouille ausweichen und wären fast entdeckt worden, doch Kalkarib konnte Radromir noch rechtzeitig zurück in den Schatten ziehen.
Im Gang des Kerkers angekommen, sahen sie die bemitleidenswerte Wache dort allein sitzen. Er saß auf seinem verbliebenen Schemel, ein angeschnittenes Stück Käse und ein abgerissenes Stück Brot lagen auf dem Tisch und der Oberkörper der Wache lag auf dem Rest desselben, anscheinend war er im Sitzen eingeschlafen. „Das wird einfach“, gluckste Yaqi freudig und steckte ihr Kurzschwert weg. Sie sprachen sich kurz ab, schlichen sich dann an und zu dritt war es für sie ein leichtes, die schlafende Wache zu überwältigen. Die Wache, ein junger Mann, der gerade einmal im Alter von Kalkarib war, hatte bei der Befragung Todesangst in den Augen und würde ihnen wohl alles verraten. Während Yaqi und Radromir ihn festhielten, baute Kalkarib sich vor ihm auf, um dann mit seinem stärksten Novadi-Akzent zu sagen: „Du verrätst mir jetzt, wo der Rabenmund-Bengel die Gefangenen hinbringt, oder ich schwöre dir, bei Rashdul, dass ich dir was abschneiden werde.“ Der Akzent entfaltete seine Wirkung, denn Kalkarib wusste, dass dieser für Mittelländer angsteinflößend wirkte. Er legte zudem das Ende seines Säbels zwischen die Beine der Wache und stocherte damit ein wenig an der sensiblen Stelle herum. Zudem war es wohl sowohl seinem gespielt starken Akzent, als auch der Arroganz der Mittelländer geschuldet, dass es niemanden auffiel, dass er ‚Rashdul‘, und nicht ‚Rastullah‘ sagte. Wenn er schon so eine Scharade innerhalb einer anderen Scharade spielen musste, musste er nicht auch noch den Namen des Alleinen beschmutzen. Dass die ‚Unschätzbar Alte‘, wie man die Stadt in Mhanadistan auch noch nannte, so ähnlich klang wie seine Gottheit, war außerdem gerade mehr als dienlich. Mit zitteriger Unterlippe und Tränen in den Augen, war dem junge Wachmann anscheinend nach Kooperation zumute: „D-Die w-werden da … da … da hinten hingebracht. Der Gang … da …“ er nickte mehrfach in eine Richtung. „… dort lang. D-d-d-dann die zweite Tür zur rechten Hand.“ Kalkarib nahm den Säbel weg, was schlagartig dazu führte, dass sich der junge Wachmann etwas entspannte. Als Kalkarib sah, wie Yaqi nach ihrem Streitkolben griff, denn für sie waren sie fertig mit ihm, kam ihr Kalkarib zuvor, indem er mit dem Knauf des Säbels dem Wachmann kurzerhand gegen die Schläfe schlug, woraufhin dieser sofort das Bewusstsein verlor und erschlaffte. Yaqi und Radromir legten ihn im Anschluss vorsichtig ab, jedoch eher, um keinen unnötigen Laut zu verursachen und nicht um ihn zu schonen. „Dann lasst sie uns holen“, flüsterte Kalkarib und ging nicht weiter auf die Situation eben ein. Gedanklich zählte er die Sünden, die er beging und Mord sollte nicht dazu gehören.
Die zweite Tür zur rechten Hand, wie der Wachmann sagte, war so unscheinbar wie alle anderen auch und noch dazu unbewacht, was sowohl ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein konnte, dachte Kalkarib. Zu dritt lauschten sie zuerst an ihr, doch vernahmen sie keinen Laut aus dem Innern. Als sie die Tür vorsichtig öffnen wollten, stellten sie fest, dass sie verschlossen war, was Radromir ins Spiel brachte. Fast schon wie ein eingespieltes Team lehnten sich der Wüstensohn und die junge Frau mit den Schlagenhautbildern am Kopf mit ihren Rücken gegen die Wand und schautet demonstrativ weg. Radromir begann sich erneut die Hände zu reiben und sein ‚Ding‘ zu machen. Sie hörten ihn flüstern, es schien fast so, als würde er ein Monolog mit dem Schloss führen, bei dem er versuchte, es dazu zu ‚überreden‘, sich zu öffnen. Es dauerte ein paar Momente und tatsächlich, das Schloss schnappte auf. Wie ein Diener, der eine höhergestellte Person die Tür aufhielt, machte er einen Schritt zur Seite und verneigte sich mit einer ausladenden Geste vor seinem ‚Herrn‘. Kalkarib trat an die Tür und drückte sie leise auf. Der Raum, der gerade einmal vier mal vier Schritt groß war und in dem es nach verschmortem Fleisch und scharfen Urin roch, war nur spärlich erhellt. Auf einer kleinen Anrichte stand eine Öllaterne und auf mehreren hohen Hockern lagern blutverschmierte gusseiserne Instrumente bereit, die Kalkarib zum Teil aus seiner Zeit, als er noch im Stall arbeitete, kannte. Ihm überkam sowohl ein Gefühl der Erleichterung als auch ein Gefühl der Übelkeit, als er Belzora in der Mitte des Raumes hängen sah. Mit zwei schmiedeeisernen Ringen an den Händen hing sie an der niedrigen Decke. Doch das war längst nicht das schlimmste. Ihr Körper war übersät mit scheinbar wahllos gesetzten Schnitten und Stichen, überall ronn frisches und altes Blut an ihr herab, vermischte sich mit ihrem Schweiß und Dreck zu seiner widerwärtig stinkenden dunklen Kruste. Ihr langes blondes Haar klebte an ihr. Trotz ihres erbärmlichen Zustands war jeder ihrer massigen und beeindruckenden Muskeln, die ihr Körper zu bieten hatte, in einem Zustand der Anspannung. Ihr Körper wurde dadurch zu einer einzigen Muskellandschaft aus Hügeln und Tälern, die erneut in Kalkarib ein warmes Glühen in seiner Körpermitte aufkeimen ließ. Er stürzte voran, er musste wissen, ob sie noch lebte. Seine Hände griffen nach ihrem Kopf und als er spürte, dass noch Wärme in ihr war, fiel ihm ein Stein von Herzen. „Belzora? Bist du wach?“, hauchte er mit sanftem Akzent und suchte sie nach Verletzungen im Gesicht ab, da auch dieses Blutverschmiert war. „Hey, kleiner“, sagte sie und lächelte ihn mit blutigen Zähnen und aufgeplatzten Lippen an. „Du siehst furchtbar aus, du musst mehr essen.“ Belzoras Worte überraschten Kalkarib, so dass er zuerst nicht bemerkte, dass sie nur scherzte. Hinter ihm begann Yaqi zu kichern. „Dir geht’s anscheinend besser als du aussiehst. Wir sind hier, um dich zu retten“, sagte Kalkarib, der das offensichtliche aussprach und nach einer Möglichkeit suchte, sie zu befreien. Die Handschellen waren mit Schlössern versehen und einen Schlüssel sah er auf Anhieb nicht. „Radromir, kannst du …?“ Kalkarib deutete auf die zwei Schlösser die Belzoras Handfesseln sicherten. „Ähm, ja … ich kann es … versuchen.“ Er trat heran und tastete eines der Schlösser in Deckenhöhe ab, während sich Yaqi und Kalkarib im Raum nach einem banalen Schlüssel umsahen. „Wo sind die anderen?“, fragte Belzora nuschelnd, der es schwer fiel deutlich zu sprechen, da ihre Lippen von der Folter angeschwollen waren. „Die sind … schon vor.“ Kalkarib entschied sich für die diplomatische Antwort, doch Yaqi schob eine etwas ehrliche Variante hinterher: „Karmold, die feige Sau, hat dich hier hängen lassen und ist abgehauen.“ Belzora schnaufte wissentlich. Anscheinend war ihr bewusst, dass es unter den ihrigen jemanden gab, der nur darauf gewartet hatte, die Führung zu übernehmen. Kalkarib wurde wieder bewusst, dass er sich hier nicht unter einer Gruppe ehrhafter Vertreter des Mittelreiches befand, sondern unter einem Haufen gefangenen Galottaner, für die Verrat und Heimtücke Alltag waren. Doch auch unter Solchen konnte man Ehre finden, dachte er sich. Immerhin hatte Belzora ihm grundlos geholfen. Und Yaqi und Radromir waren ebenfalls hier, um ihm zu helfen und sie zu befreien. Anscheinend gab es auch in den dunkelsten Landen einen Funken Licht und Hoffnung. „Meh, ich kann den Schlüssel nicht finden.“ ächzte Yaqi, die gerade in einem Eimer voller blutiger Lumpen gewühlt hatte. „Sucht ihr den hier?“, tönte eine arrogante und junge Stimme von der Tür und sofort rutschte Kalkarib das Herz in die Hose. Sie alle erstarrten als sie rumfuhren und zur Tür schauten, wo zwei gerüstete Wachen standen, kalten Stahl in den Händen, während hinter ihnen, gerade so über die Schultern hervorguckend, das makellose und blonde Gesicht des Rabenmunder Bengels zu sehen war, der verspielt einen kleinen Schlüssel in der Hand hielt. Kalkarib hatte instinktiv seinen Säbel herausgezogen und auch Yaqi hatte ihren Streitkolben schon in der Hand. Während Radromir noch hastig nach seinen Langdolch, den er in der Waffenkammer hatte mitgehen lassen, fingerte. Währenddessen schoben sich vier bewaffneten Wachen in den Raum und stellten sich nebeneinander auf. Kalkarib wog die taktische Situation ab: Sie waren nur zu dritt, da Belzora keine Hilfe war, ganz im Gegenteil, sie war sogar ein taktischer Nachteil, da sie mitten im Raum blutig von der Decke hing. Hinzukommend waren sie nur spärlich bewaffnet, wohingegen die vier Rabenmunder Wachen allesamt Äxte und Streitkolben hatten. Zu ihrem Glück trug keiner von ihnen Kettenhemden oder andere metallene Rüstungen, da sie auf ihrer eigenen Burg schließlich nicht erwarteten auf Feinde zu treffen. Additiv war da noch der Bursche, doch der schien sich im Moment eh rauszuhalten und war nur mit einem Dolch bewaffnet, weshalb Kalkarib, die Situation abwiegend, „Lasst uns verhandeln“, vorschlug.
Teil VI – Die Sehnsucht nach Geborgenheit (3)
Im Kerker von Burg Rabenmund – 22. Peraine, 34 nach Hal – In der Nacht
Stille war in den Kerker eingekehrt, doch ob das ein gutes Zeichen war, vermochte Kalkarib nicht einzuschätzen. Kein Laut drang zu ihnen, nachdem sie Belzora an seiner statt geholt hatten. Vielleicht war sie wirklich so stark wie sie aussah, oder vielleicht war ihr Geist sogar noch stärker. Zumindest redete der Wüstensohn sich das ein, denn an etwas anderes wollte und konnte er einfach nicht glauben. Sie hatte sich, um ihn zu retten, nach vorne gestürzt und so ihr eigenes Schicksal besiegelt. Spätestens jetzt befahl ihm seine Ehre, dass er in ihrer Schuld stand. Doch eins nach dem anderen. Im Moment stand er zusammen mit den anderen Insassen, die allesamt so sehr stanken, dass er das Gefühl hatte, inmitten eines Dunghaufens zu stehen, direkt vor der Zellentür, an der sich der Scharlatan Radromir gerade zu schaffen machte. Zuvor hatten sie an ebendieser gelauscht, um sicher zu gehen, dass die Wache gerade nicht auf ihrem Platz war. Es gab also ein kleines Zeitfenster, an dem sie etwas lauter sein konnten. „Jetzt mach schon“, zischte jemand ungeduldig. „Was dauert denn da so lange?“, sagte eine andere Stimme. „Pscht!“, zischte es von vorne zurück. Der langhaarige Radromir, in dessen braunen und welligen Haaren ganz viel Stroh steckte, fuhr mit finsterem Blick herum. „So geht das nicht“, intonierte er melodramatisch und machte eine Geste mit den Händen die so aussah, als würde er etwas zerbrechliches in den Händen hälten. „Ich brauche dafür … Ruhe, ja? Und ein wenig Zeit.“ Er drehte sich wieder zur Tür, während einige der anderen nur mit den Augen rollten oder ungeduldig ihr Gewicht von einem auf das andere Bein verlagerten. Wieder vergingen einige Momente. Kalkarib blickte angespannt zwischen den umstehenden Mitinsassen umher, die ihm allesamt einen respektvollen Abstand gaben: Links neben ihm stand ‚Halbhand‘, der – wie sich später herausstellte – eigentlich Tharsonius hieß, weshalb Kalkarib ihn weiterhin gedanklich als ‚Halbhand‘ in Erinnerung behielt, da er sich den Namen nicht hätte merken können. Dieser kannte die Burg, den Weg zur Waffenkammer und den vermeidlichen Fluchtunnel, von dem er den anderen nicht erzählen wollte. ‚Zu meiner eigenen Sicherheit‘, sagte er und Kalkarib konnte in anbetracht der anderen Insassen sehr gut nachvollziehen, wieso er damit hinter dem Berg hielt. An seiner Stelle würde er sich wohl genauso verhalten, immerhin wurde er so zu einer taktisch beschützenswerten Person. Zu seiner rechten stand Yaqi, ein junges und hageres, aber nicht minder muskulöses Weib mit sehr kurzen Haaren und Hautbildern mit Schlangenmotiven auf beiden Kopfseiten, die, als Kalkarib vorhin nach Belzoras Entfürung das Wort erhob, die erste war, die ihn unterstützte. ‚Lasst ihn ausreden!‘, fauchte sie mit einer so garstigen Bestimmtheit, dass man glaubte, ein Fluch käme über jeden, der es wagen würde, ihr zu widersprechen. Denn kurz nach Belzoras Entführung war es Kalkarib, der das Wort ergriff, um die Tobrier dazu zu bringen jetzt nicht zu verzagen und an Belzoras Plan festzuhalten. Doch hatte er nicht damit gerechnet, dass es selbst hier, im Kerker auf Burg Rabenmund, soetwas wie eine Hierarchie, oder sollte man besser sagen ‚Hackordnung‘, gab. Er wurde nämlich jäh von einem älteren Mann unterbrochen, sein Name war Karmold, der Kalkaribs Autorität sofort in Frage stellte. ‚Was glaubst du wohl wer du bist, Novadi! Es ist niemand mehr da, der dich beschützt!‘ Das waren seine Worte, als er aufstand und sich vor ihm aufbaute. Auch wenn er Schmerzen im Bein hatte, so stellte sich Kalkarib ihm gegenüber, um ihn die Stirn zu bieten. Zu seinem Glücke war da Yaqi, die genau in diesem Moment dazwischen ging, denn ohne seine Waffen und in seinem Zustand, wäre er dem offensichtlichen kriegsgestandenen alten Mann unterlegen gewesen. Kalkarib bestand darauf, den Plan weiter auszuführen und Belzora aus der hochnotpeinlichen Befragung zu befreien, in der sie sich ohne Zweifel befand und dass er und die andere es ihr schuldeten. Es war ihr einziger Weg in die Freiheit und nur eine Frage der Zeit, bis der Knabe jeden hier einen nach dem anderen rausgeholt haben würde. Jeder sollte sich also die Frage stellen, ob er bereit war, sich heute seine Freiheit wieder zu holen oder ob er lieber hier auf Burg Rabenmund sterben wollte. „Und was macht dich zum neuen Anführer?“, wollte der grauhaarige Karmold wissen und schob dabei provizierend das Kinn nach vorne. Kalkarib dachte zuerst an Sieghelm, doch ihm wurde schnell genug bewusst, dass er ihn nicht als Argument benutzen konnte. Er kramte in seinen Gedanken nach einem anderen Argument, irgendetwas, das er diesen verzweifelten Männern und Frauen anbieten konnte, das sie davon überzeugen würde, ihm zu folgen. So sehr er sich auch anstrengte, ihm fiel auf die Schnelle nichts ein. Er brachte daher nur ein abgehacktes ‚Weil …‘ heraus. Der alte Karmold nutze Kalkaribs Moment der Unsicherheit, wandte sich an die Zelleninsassen und posaunte überheblich heraus: ‚Seht ihr! Er weiß es nicht. Lasst uns also nichts überstürzen und die Situation neu bewerten.‘ Kalkarib sah, wie einige der Insassen nickten und andere unsicher zwischem ihm und seinem Herausforderer hin- und her schauten. Er konnte ihn unmöglich angreifen, Karmold war zwar ebenfalls in einem heruntergekommenen Zustand, doch sein sehniger Körper und die vielen Narben erweckten den Eindruck, dass er sich auch schon so manch nachteiliger Situation befreien konnte. Eine körperliche Konfrontation war für den Wüstensohn daher im Moment ausgeschlossen, was ihn wütend werden ließ. Wütend darüber, wie er überhaupt in diese Situation geraten war, wütend über die Lüge, die er hier im Kerker leben musste und dass ihm nicht einmal die Wahrheit vor schlimmeren bewahren konnte. Mit geballten Fäusten machte er einen Schritt nach vorne, heran an Karmold, der sich seines Sieges schon sicher war und sich wegen Kalkaribs Herantreten nun erneut aufbaute. ,Weil …‘ setzte der Novadi erneut an, wobei dieses Mal viel mehr Tiefe in seiner Stimme lag. Er fixierte seinen Kontrahenten, er spürte wie die heißspornige Wut in ihm hochkochte und er alle Kraft aufwenden musste, um nicht unkontrolliert auf ihn loszugehen. Er hörte sich die folgenden Worte sagen, war sich jedoch nicht seiner Erscheinung dabei bewusst, die alle anderen in dieser Kerkerzelle wahrnahmen. Seine braunen Augen wurden schlagartig zu roten Feuerbällen und eine Brust schwoll an und glomm von innen heraus wie ein heißer Kohlenofen, als er sagte: ‚Der Alleinige ist mein Zeuge – Weil du es bereuen würdest dich mit mir angelegt zu haben, so wahr ich hier stehe stehe.‘ Kalkarib war heiß, er spürte wie sein Blut in ihm kochte und sein Körper pulsierte, als er dies sagte. Es fühlte sich an, als wäre er ein Fass, das bis zum Überlauf gefüllt war mit kochendem Wasser. Nur ein kleiner Tropfen würde genügen, um es zum Bersten zu bringen. Doch entgegen Kalkaribs Erwartung, bekam Karmold große, furchterfüllte Augen, legte seine Hände schützend vor sein Gesicht und nahm eine unterwürfige Haltung ein. ‚Ganz ruhig, ganz ruhig‘, begann er wimmernd, was das Gemüt des Wüstensohns ein wenig abkühlte. Seine glühende Brust verglomm, als er die beschwichtigenden Worte seines Kontrahenten vernahm. ‚Wir müssen es ja nicht gleich überstürzen. Vielleicht sollten wir, ähm, an Belzoras Plan festhalten.‘ ‚Ja, genau das werden wir tun‘, sprach Kalkarib, dessen rotglühenden Feuerbälle sich wieder zu braunen Augen normalisierten. ‚Und wir werden sie nicht nur retten, sondern auch sicher hier rauskommen.‘ Seit diesem Moment wagte es niemand mehr etwas gegen Kalkarib zu sagen. Er selbst hatte es nicht mitbekommen, wie sein innerstes Geheimnis kurz davor war aus ihm herauszubrechen, doch das Spektakel entfaltete sofort seine Wirkung und seit diesem Moment gaben alle Mitinsassen ihm ein kleines bisschen mehr gebührenden Abstand als zuvor.
Ein kaum hörbares metallisches Klicken war zu vernehmen. Radromir drehte sich mit einem verschmitzen Lächeln um und nickte. „Es ist offen“, flüsterte er und trat sofort beiseite. Er war zwar derjenige, der die Tür öffnen konnte, aber gewiss nicht der, der zuerst hindurch durchtreten würde. Das überließ er lieber jemand anderen. Doch niemand machte die anstalten die Zellentür zu öffnen, stattdessen schauten die Insassen nur nervös hin und her und bald schon wurde Kalkarib mit mehreren auffordernden und hoffnungsvollen Blicken belegt. Ehe er realisieren konnte, was gerade geschah, schob sich auch schon der grauhaarige Karmold nach vorne zur Tür durch. „Ich gehe zuerst“, sagte dieser, was Kalkarib recht war. Der grauhaarige Tobrier drückte vorsichtig die Tür auf, dahinter lag ein schmaler Gang, der nach links und rechts abging und nur von schwachem Fackelschein erleuchtet wurde. Zaghaft folgten ein paar der Mitinsassen. Karmold wandte sich an Halbhand und erkundigte sich nach dem Weg. Dieser sah sich suchend um und nach einem kurzen Augenblick deutete er selbstsicher in eine Richtung. Es war ein seltsames Schauspiel, das sich in den nassfeuchten Kerkermauern abspielte. Über ein dutzend Männer und Frauen, ausgemergelt und am Rande der Erschöpfung, gezeichnet durch Mangelernährung und schlechter Unterbringung, versuchten mehr schlecht als recht auf abgetreten Stiefeln oder gar barfuß so leise wie möglich durch einen schmalen Gang zu schleichen. Während sich der ein oder andere recht geschickt dabei anstellte, sich duckte, klein machte oder sich, soweit es möglich war, im Schatten aufhielt, gab es andere, die sich fast schon übertrieben aufrecht und ganz und gar nicht lautlos fortbewegten. Kalkarib gehörte eher zur ersten Gruppe, wobei sein verletztes Bein es ihm immernoch etwas schwer machte. Aus reiner Verzweiflung und in Ermangelung besserer Alternativen, entschied sich Yaqi, die junge Tobrierin mit den Hautbildern auf dem Kopf, dazu, den hölzernen Schemel der Wache als improvisierte Waffe mitzunehmen, was Kalkarib mit einer Mischung aus Grinsen und anerkennendem Nicken quittierte. Zwei Abzweigungen und eine Wendeltreppe, die sie nach oben führte, später, erreichten sie die vermeidliche Waffenkammer. „Da vorne ist sie“, flüsterte Halband, zeigte mit zwei Fingern auf eine Tür und zuckte dabei unkontrolliert mit dem Augenlid. Doch die Tür wurde bewacht, an einem Tisch saßen zwei Wachen in schwarzweißen Rabenmund-Wappenröcken und spielten gelangweilt miteinander Karten. Von ihrer Position aus mussten sie mindestens fünf Schritt bis zu ihnen überbrücken, was den Wachen – selbst, wenn sie überrascht waren – genug Zeit gab, auf ihr Anstürmen zu reagieren. Sofort machte sich Zweifel breit und Kalkarib hörte wie die Leute hinter ihm entmutigt miteinander flüsterten, wie sie dies bloß bewerkstelligen sollten. Kalkarib musste etwas unternehmen, ehe die Leute begannen, etwas Dummes zutun. Er packte Karmold an der Schulter und bekam dadurch seine Aufmerksamkeit. „Du übernimmst die rechte, ich den linken.“ Kaum hatte er es ausgesprochen, warf Karmold einen ungläubigen Blick zu den Wachen. „Hat dich der Namenlose geritten, Novadi? Wir zwei gegen die?“, zischteder gealterte Kämpfer ungläubig und deutete bei sich selbst an die Stelle, an der normalerweise eine Waffe hing. „Mit einer Waffe, kein Problem, aber so … vergiss es“, schob er noch hinterher und schüttelte den Kopf. „Ohne mich“, sagte Karmold. „Dann mach ich es.“ Kalkarib blickte zu der Stimme, die zu Yaqi gehörte, die ihren hölzernen Wachschemel schon kampfbereit in den Händen hielt. Karmold machte bereitwillig für Yaqi Platz, die an seiner statt nach vorne trat. „Gut, dann wir“, entschied Kalkarib mit einen Blick auf den Schemel. Auch wenn ein bisschen Wahnsinn in den Augen der jungen Frau lag, so kam es ihm gerade nur mehr als recht. „Ich werde sie ablenken. Du kommst dann nach, sobald sie dir den Rücken zugedreht haben“, befahl er im Novadi-Akzent und wartete ihr bestätigendes Nicken ab. Er atmete ein letztes Mal tief durch und trat dann aufrecht aus dem Schatten zu den Wachen heran. „Salamaleikum, meine Freunde!“, sagte er in seinem besten Garethi und streckte dabei seine Arme ganz weit aus. „Eure Götter haben uns eine wundervoll kühle Nacht geschenkt, bei der selbst Rastullah neidig werden würde“, fuhr er fort und trat dabei Schritt für Schritt näher an die Waffenkammer heran. Die Wachen, eine Frau mit langem braunem Zopf und ein Mann mit ledriger Haut und einem dichten, zotteligen Bart, hatten sich inzwischen erhoben und ihre Hände an ihre Streitkölben gelegt. „Ich danke Rondra dafür, dass euer Herr mir meine Freiheit geschenkt hat, gepriesen sei die Weisheit das Hauses Rabenmund!“ Inzwischen hatten sich die beiden Wachen direkt vor die Waffenkammertür gestellt und Kalkarib stand genau vor Ihnen, was aufgrund des Winkels der Tür zu dem Gang, in dem die Tobrier warteten, dazu führte, dass sie jetzt mit dem Rücken zum Gang standen. „W-Wer bist du?“, platze es aus der Wache heraus. „Wer ich bin?“, entfuhr es Kalkarib mit gespielt höchster Empörtheit. „Ich bin die Spektabilität der geheimen Wüstentruppen der Magierakdemie zu Punin“, improvisierte er, vollführte dabei eine ausladene Geste und hoffte, dass Yaqi jeden Moment den Holzschemel über den Kopf der Wache ziehen würde. „Geheime Wüstentruppen? Was für Wüstentruppen?“, hakte die Wache nach und strich sich nachdenklich mit der Hand durch seinen Bart. „Die des …. Kalifen Malkillah, im Auftrag von Bey Nehazet ibn Tulachim.“ Kalkarib sah, wie seine flüchtig improvisierte Scharade so langsam einzustürzen drohte, weshalb er ins Schwitzen geriet, denn lange würde er die Wachen nicht mehr hinhalten können. „Bey Nehazet? Von dem habe ich schon mal gehört“, sagte die Frau und wirkte ernsthaft interessiert. „Ist das nicht der Prophet der …“ KNACK! Die Frau wurde jäh von einem hölzernen Schemel unterbrochen, der mit hoher Geschwindigkeit auf ihrem Hinterkopf aufschlug und sie auf der Stelle nicht nur zu Boden, sondern auch aus ihrem Satzbau schleuderte. Hinter ihr kam die breit grinsende Yaqi zum Vorschein. Kalkarib, der nur für einen kurzen Moment abgelenkt war, packte den langen Stil des Streitkolbens vom Wachmann und drückte mit aller Kraft dessen metallenen Kopf in Richtung des anderen fleischlichen. Noch ehe die Rabenmunder Wache seine Muskeln anspannen und seine Niederlage damit verhindern konnte, traf das Spitze des Streitkolbens seine Stirn, woraufhin er ohne Umschweife mit einer blutigen Wunde zu Boden sackte. Beide Wachen waren ausgeschaltet und ein Alarm schien ausgeblieben zu sein. „Was hast du so lange gemacht?“, erkundigte sich Kalkarib nervös bei Yaqi. „Ich war mir nicht ganz sicher auf welcher Seite du bist“,entgegnete die kahlköpfige Frau und brach in ein unterdrücktes Kichern aus. Kalkarib, der mit dieser Reaktion nicht so recht umzugehen wusste, entschied sich ebenfalls zu einem schwachen Grinsen, manchmal war es besser einfach nicht nachzufragen. Karmold und Yaqi nahmen die Streitkölben der Wachen ansich, während die anderen sie nach anderen Kurzwaffen und Münzen absuchten. Kalkarib winkte Radromir heran, denn mit Sicherheit war die Waffenkommen ebenfalls abgeschlossen. Dieser hüpfte angewidert über die betäubten Wachen und machte sich sofort am Schloss zu schaffen. „Gebt mir einen Moment der Ruhe, ja?“, sagte er noch und blickte die direkt bei ihm stehenden Yaqi und Kalkarib lange an. „Ich kann nicht wenn jemand guckt“, schob er noch hinterher und wirkte dabei wie ein kleines Kind, das soeben aus Versehen die Lieblingsvase ihrer Mutter kaputt gemacht hatte und reumürig um Vergebung bat. Mit einem synchon langen Ausatmen drehten sich Kalkarib und Yaqi um und blickten demonstrativ in andere Richtungen. Wäre die Situation, in der sie sich befanden, nicht so lebensbedrohlich gewesen, wäre sie absurd genug, um daraus eine Szene für ein Bühnenstück auf den Schauspielbühnen Havenas zu machen. Kurze Zeit später war auch diese Tür geöffnet und tatsächlich, sie hatten die Waffenkammer gefunden, welche jedoch entgegen ihrer Erwartung sehr leer war. Dann wurde ihnen bewusst, dass ja ein großteil der Besatzung der Burg momentan nicht hier war und sie daher nur noch wenig Ausrüstung hier hatten. Doch der spärliche Rest genügte, um sie trotzdem alle zu bewaffnen. Kalkarib fühlte sich für einen kurzen Augenblick lang sehr glücklich, als er unter einem grob gewebten Tuch seinen Säbel wiederfand. Auch, wenn es ihm nicht unbedingt den Erfolg sicherte, aber er war der Freiheit damit ein Stück näher gerückt und hatte sein Schicksal nun wieder in seinen eigenen Händen, zumindest fühlte es sich für ihn so an. „So, auf geht’s, holen wir Belzora und dann verschwinden wir von dieser Burg“, waren seine Worte, als er mit seinem Khunchomer die Waffenkammer verließ und vor sich einen kleinen Haufen Tobrier vorfand, die nicht nur bewaffnet, sondern auch noch in höchsten Maßen bereit waren ihm und seinem Befehl zu folgen. Er verschwendete keinen Gedanken daran, dass er gerade zum Anführer eines verfeindeten Trupps geworden war, der eine verfeindete Gefangene befreien wollte und bereit war, dafür verbündete Streitkräfte zu töten.
Teil VI – Die Sehnsucht nach Geborgenheit (2)
Im Kerker von Burg Rabenmund – 22. Peraine, 34 nach Hal – Gegen Mittag
Kalkarib musste den ganzen Tag im Kerker von Burg Rabenmund an Belzoras Worte denken: Heute Nacht werden wir fliehen. Immer wieder testete er sein verletztes Bein, spannte es an, drehte es und stieß es vorsichtig gegen die Wand, um herauszufinden, wie belastbar es war. Die Verbände mussten zwar dringend gewechselt werden, doch Adellindes Wundversorgung schien wirklich hervorragend zu sein, auch wenn er den Schmerz noch spürte, so würde ihn sein Bein bei einem vermeidlichen Fluchtversuch nicht allzu sehr einschränken. Doch sein Bein war nicht seine einzige Sorge, die ihn den ganzen Tag über quälte. Was, wenn er, oder dieser Radromir, der in der Lage sein soll, das Schloss auf magische Weise zu öffnen, von dem jungen Rabenmund-Spross aus der Kerkerzelle geholt werden. Der Wüstensohn spürte, wie ihm seine Sorgen die Kehle zuschnürten. Nicht, dass er etwa hätte sagen wollen, doch das Unbehagen in ihm wurde immer mächtiger. Der ganze Plan Belzoras hing an einem seidenen Faden und warum waren sie nicht schon früher geflohen, wenn sie in der Lage waren, die Kerkertür zu öffnen? Er traute sich nicht es anzusprechen, denn er wusste, jedes Gespräch mit ihr barg potenziell die Möglichkeit in sich, seine ungewollte, aber lebenssichernde Tarnung auffliegen zu lassen. Irgendwann am Nachmittag wurde ihnen eine große Schüssel Haferbrei hereingereicht, Belzora, die so etwas wie Anführein hier in Kerker war, nahm sie sofort an sich und stellte sie, ohne auch nur ein Wort zu sagen, zuerst vor Kalkarib, ohne dass sich jemand wagte dem zu widersprechen. „Hier, wenn du zuerst davon isst, ist es vielleicht nicht ganz nach deinen Gesetzen, aber besser, als wenn die anderen ihre Finger drin hatten“, sagte sie und setzte sich im Schneidersitz vor ihn hin. Würde sie ihm jetzt etwa beim Essen beobachten? „Danke, ich …“, entgegnete er mit hauchender Stimme, „… habe keinen Hunger.“ Was glatt gelogen war, er hatte sogar einen solchen Hunger, dass er jetzt einen ganzen Feigenbaum hätte leer essen können, aber als er einen Blick in die Schale warf, überkam ihn ein spontaner Würgereiz. Er hatte ohnehin noch nie verstanden, wie diese Mittelreicher diesen Schleim essen konnten, aber den Brei, den er sonst von seinen Mitreisenden kannte, sah wenigstens etwas appetitlicher aus als dieser, der ihn eher an eine Pferdetränke erinnerte, die seit Wochen nicht mehr gewechselt wurde. „Du musst etwas essen.“ Belzoras Worte waren streng, aber dennoch liebevoll, wie die Worte einer Mutter zu ihrem Kind, wenn es krank war und unbedingt etwas essen musste, um wieder gesund zu werden. „Du musst zu Kräften kommen für heute Nacht“, schob sie hinterher und tippte auf den Rand der Schüssel, wobei sie ihn mit ihren blauen Augen so fest anstarrte, dass sich Kalkarib weder traute zu verneinen, noch ihr in die Augen zu schauen. Er musste das Spiel mitspielen, das war klar, und dazu gehörte auch die Flucht aus den Fängen der mittelreichischen Adelsfamilie, die eigentlich auf seiner Seite waren. Er schluckte einen Klos im Hals herunter und holte sich, seinen Ekel beiseite schiebend, etwas von den stückigen Morast aus der Schüssel. Als er es sich in der Mund schob wollte sein Körper es am liebsten sofort wieder ausstoßen, doch er zwang sich es herunterzuschlucken. „So ist es gut, nimm noch etwas.“ Belzoras Lippen formten ein Lächeln. Sie gab einem der anderen ein Zeichen, der sich sofort an die Zellentür begab, um zu lauschen, ob draußen vor der Kerkertür jemand war. Als er den Kopf schüttelte kauerte sich die kräftige Frau auf den Boden und zischte einmal kurz, woraufhin die ganzen Insassen, die überall verstreut lagen begannen sich wie Widergänger zu erheben und um sie zu scharren. Während Kalkarib mit den zweiten ‚Bissen‘ kämpfte, zählte er das erste Mal, wie viele es waren. Aufgrund des kleinen Fensterspalts und der auf- und übereinander liegenden Personen war es ihm bisher schwergefallen. Er zählte, mit sich und Belzora, insgesamt 15 Gefangene. Ob das reichen würde, um eine voll ausgestattete und alarmierte Wachmannschaft zu überwältigen und von einer gesicherten Burg zu entkommen? Er zweifelte daran, doch andererseits blieb ihm nichts anderes übrig, denn auf Rettung zu warten war für ihn keine ernstzunehmende Option. Nach dem zweiten widerlichen Happen vom Brei beschloss Kalkarib die Schüssel an die anderen weiterzugeben und gesellte sich zu der verschwörerischen Runde dazu, angeführt von der blonden Tobrierin, deren schmutzigen Oberschenkelmuskeln in der hockenden Pose noch mehr als sonst zur Geltung kamen. „Der Plan ist folgender …“, begann sie im leisen Tonfall und berichtete detailliert davon, wie sie vorgehen würden. Dabei wurde Kalkarib auch klar, wieso sie nicht schon die letzten Tage versucht hatten zu fliehen: Sie hatten kurz vor Kalkaribs Ankunft vernommen, dass heute, in der Nacht vom 22. auf den 23. Peraine, erneut ein Großteil der bewaffneten Mannschaft ausreiten würde und nur eine Minimalbesatzung auf der Burg zurückbleiben würde. Das heißt, ihre Chancen zu fliehen würden steigen. Dieser Radromir, so schätzte es Kalkarib zumindest ein, musste ein Scharlatan oder soetwas sein, der ein paar kleine Zaubertricks konnte, darunter unter anderem einen, mit dem er Schlösser öffnen konnte. Belzoras Plan war es, die Nachtwache zu überwältigen und zur Rüstkammer zu kommen, um sich und die anderen die bewaffnen. Kalkarib hoffte, dass auch seine Sachen dabei sein würden, denn mit den Waffen der Mittelreicher war er nicht vertraut. Einer von ihnen, ein schlanker Mann, dem an der rechten Hand zwei Finger fehlten und der immer wieder hektisch mit einem Auge zwinkerte, schien den Aufbau der Festung gut zu kennen, denn Belzora erwähnte, dass er schon mal hier war und sie ihm folgen müssten, um zu einem geheimen Ausgang zu kommen. Sie konnten schlecht die Festung über das geschlossene Haupttor verlassen. Das Gitter hochzuziehen und das schwere Holztor zu öffnen, würde zu viel Aufsehen erregen, zumal sie wahrscheinlich zu wenige waren, um dies zu bewerkstelligen. Warum der ‚fingerlose‘ Mann, den Kalkarib gedanklich ‚Halbhand‘ taufte, Burg Rabenmund so gut kannte, dass er sogar den geheimen Ausgang kannte, war ihm schleierhaft, doch im Moment war er eine sehr wichtige Person für den Erfolg ihrer Flucht, weshalb Belzora befahl, dass er auf jeden Fall zu beschützen sei. Er war es auch, der wusste, wo sich die Rüstkammer befand. In verschwörerischem Tonfall schloss Belzora dann die Unterredung: „Das ist der Plan. Denkt daran, egal wer von uns dieser Nacht von dem Rabenmund-Kind ausgewählt wird, muss dichthalten. Wir werden keinen Aufstand wagen, egal wer geholt wird. Wir werden so oder so kurz danach ausbrechen und ihn befreien, also spielt auf Zeit.“ Die Männer und Frauen nickten. Das war ein kluger Schachzug von ihr, dachte sich Kalkarib. So versicherte sie sich, dass der oder diejenige Stillschweigen bewahren würde bei der Folter. Sie sagte das mit einer solchen Überzeugung, dass sich der Novadi nicht sicher war, ob sie wirklich die Wahrheit sagte, oder ob es nur ein Mittel war, um den Fluchtplan sicherzustellen. Es gab also zwei Schlüsselpersonen für den Erfolg, Radromir der Scharlatan, der Schlösser öffnen konnte und ‚Halbhand‘, der wusste, wie der schnellste Weg zur Waffenkammer war und wo sich der geheime Ausgang befindet. Kalkarib prägte sich die Gesichter der beiden gut ein, denn alle anderen waren entbehrlich. Da ertappte er sich bei dem Gedanken, dass das nicht für Belzora galt, denn in seinem Verständnis von Ehre schuldete er ihr etwas. Er war sich nicht sicher was, aber er stand in ihrer Schuld.
Die Stunden bis zum Abend waren zäh wie Trockenfleisch, es fiel Kalkarib schwer, einen klaren Gedanken zu fassen und sich zu fokussieren. Wie er doch die Gebete zu Rastullah vermisste, sie gaben ihm Fokus und Klarheit im Geist, befreiten ihn von liderlichen Gedanken und reinigten seine Seele. Seit Tagen hatte er nun nicht mehr gebetet und ihm wurde schmerzlich bewusst, dass er seinen Gebetsteppich wohl nicht in der Waffenkammer finden würde. Doch wenn er erst einmal draußen sein würde, könnte er sich zum Gebet wenigstens etwas von den anderen zurückziehen, der All-Eine würde es ihm verzeihen. „Kalkarib?“, hörte er die Stimme Belzoras, die ihn aus seinem Gedankenpalast riss. „Ja, was ist?“, sagte er im barschen Tonfall. „Bist du bereit für heute Nacht?“ „Ja, bin ich.“ Was hätte er auch anderes sagen sollen? „Ich meine wegen deinem Bein – kannst du gehen?“, erkundigte sie sich und schien ernsthaft besorgt zu sein. Kalkarib setzte sich auf, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Kerkerwand und sah sie an. Ihr strubbeliges langes Haar umspielte ihr markantes Gesicht und ihre Augen sahen ihn auf eine Weise an, die in ihm gleichwohl Unbehagen und den Drang nach Vertrautheit hervorriefen. Noch immer war ihm nicht klar, was die kräftige Frau in ihm auslöste, noch nie zuvor hatte er für eine andere Person solche Gefühle empfunden. „Es wird gehen, mach dir um mich keine Sorgen“, sagte er im typisch novadischen Akzent und so willensstark er im Moment konnte, denn er durfte jetzt keine Schwäche zeigen. Auch wenn ihm inzwischen klar war, dass sie aus absurd ersthaft persönlichen Interesse fragte und nicht aus takischen Gründen, um herauszufinden, wer das schwächte Glied in der Kette war, so wollte er aus ebenso absurden Gründen ihr gegenüber Stärke demonstrieren. Sie beugte sich plötzlich vor und ihr würzig-weibliches Odeur drang in Kalkaribs Nase, er erstarrte, als sich ihre Gesichter direkt voreiander befanden. Sie wollte ihn küssen und er war erschreckenderweise bereit dafür, doch dann schob sie ihr Gesicht im letzten Moment an dem seinen vorbei, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern, wobei ihre langen blonden Haare an seinen Wangen kitzelten und er sofort eine aufsteigende Wärme der Erregung in sich spürte. Er war in dem Moment hellwach und atmete tief aus, während er ihre warme Stimme an seinem Ohr vernahm: „Ich geb auf dich acht. Ich bring dich hier lebend raus.“ Seine Lippen zitterten, als er die Worte vernahm, die Aussicht nach Geborgenheit in ihm wurder größer denn je. Sie tätschelte noch ein letztes Mal zärtlich seine Wange, bevor sie sich zurückzog, um ihre Wadenwickel etwas strammer zu wickeln. Er vermochte nicht zu sagen warum, aber in ihm sprang sein angeborenre ‚Beschützerinstinkt‘ an: ER sollte SIE beschützen, und nicht andersherum. Er musste ihr gegenüber Stärke beweisen, doch er wusste nicht wie. In seinem Zustand war er dazu kaum in der Lage. Doch dann änderste sich adhoc seine Stimmung, als er sich dabei ertappte, wie er daran dachte, sie, die ihm völlig Fremde Tobrierin, zu beschützen. Kalkarib schämte sich, er versuchte an sein Weib, Delia, und an seinen Stammhalter zu denken, er musste die unreinen Gedanken aus seinem Kopf verbannen. So verbrachte er die nächsten Stunden damit an Zuhause zu denken, an El’Trutz und wie friedlich alles sein würde, würde er doch nur mit Delia wieder vereint Zuhause sein können. Doch die Gedanken an Delia und seine Heimat waren nicht von langer Dauer, irgendwann begann er erneut daran zu denken, wie es ihm gelang, Belzora und den Anderen Stärke zu beweisen und in ihm gährte ein Plan.
Spät am Abend war die Nacht war schon lange über Burg Rabenmund hereingebrochen und der schmale Streifen Licht, der die Kerkerzelle nur spärlich erhellte, war schon längst fort, als Schritte vor der Tür zu vernehmen waren. Sofort machte sich Anspannung breit, denn jeder wusste, dass dieser Moment nicht nur über den Ausgang ihres Fluchtplans entscheiden konnte, sondern auch über das eigene Leben. Sie hörten eine kurze Unterhaltung und das Ausstoßen eines Gelächters, anscheinend war den Wachen zu scherzen zumute. Das Schloss ächzte, als die Wache den Schlüssel herumdrehte und als die Tür aufschwang fiel das erste Mal seit Stunden wieder Licht in die Zelle. Zwei massige Wachen, mit den Händen an ihren Schwertknäufen, schoben sich hinein, dicht gefolgt von dem adrett gekleideten jungen Rabenmund-Sprössling mit den Rabensymbolen auf der Gürtelschnalle. Fast zwei Köpfe war er kleiner als die Wachen, die beim Hereinkommen hier und dort die Insassen beiseitetraten, um dem Jungspund Platz zu machen. Ein jeder verbarg sein Gesicht im Stroh oder blickte zur Wand, als sich der Spross arrogant in der Zelle umsah. Auch Kalkarib schaute weg und konnte nur einen kurzen Blick auf ihn erhaschen. Sein Gesicht war zu Belzora gedreht und im schwachen Laternenlicht trafen sich ihre Blicke. In ihren Augen spiegelte sich das Licht wider und für einen Moment musste er an den klaren Sternenhimmel in Mhanadistan denken, den er so sehr vermisste. Da wurde ihm schlagartig klar, wie er Stärke zeigen konnte. Während der Jüngling sein nächstes Opfer aussuchte, vergingen die Momente quälend langsam, in denen nur gelegentliches Scharren im Stroh oder ein verängstiges Wimmern zu hören war. Dem Wüstensohn war klar, dass der Rabenmund-Bengel jeden Moment genoss, in dem der kleine Raum mit Angst vor ihm geschwängert war. Doch Kalkarib wusste es besser. Das war nur ein unerfahrener Jungspund und er musste dies den anderen beweisen. Er musste den jungen Mann ansehen, um allen anderen und vorallem Belzora zu zeigen, dass er mutiger war sie, denn er war ein tapferer Streiter Al’Salis, ein stolzer Sohn der Wüste, der sogar schon die Niederhöllen überlebt hatte. Er drehte sich leicht, so dass er ihn direkt anblicken konnte und was er sah, erfüllte seine Erwartungen: Er sah einen jungen und hageren mittelländischen Bengel, der ein süffisantes Lächeln auf den Lippen hatte und dessen Augen den Raum nach dem nächsten Opfer sondierten. Als sich ihre beiden Blicke trafen, zwang sich Kalkarib, den Blick nicht von ihm abzuwenden, denn er, Kalkarib al’Hashinnah, war kein feiger Mann, er war besser als dieser ehrlose Wicht. „Was tust du?“, hörte er zwischen zusammengebissenen Zähnen Belzora zischen, gerade so laut, dass nur er es hören konnte, während sich die schmalen Lippen des Jünglings zu einem süffisanten Lächeln formten. „Den da“, tönte er selbstsicher und streckte einen Finger mit sichtlich sauberen Fingernagel nach ihm aus. Ohne Umschweife machten sich die Wachen daran Kalkarib zu holen und er war bereit dafür, er hatte sich extra so hingelegt, dass er den ersten mit einem Fussfeger ins Straucheln bringen oder gar zu Fall bringen konnte. Den zweiten mussten die anderen übernehmen. Er würde sich nicht feige dem Schicksal ergeben, er war bereit das Heft in die Hand zu nehmen und ehrhaft zu kämpfen. Doch noch ehe er zum Fußfeger ansetzen konnte, war Belzora schon aufgesprungen. Wie konnte sie nur so unmenschlich schnell auf den Beinen sein? Die erste Wache ächzte und brach kurz darauf zusammen, anscheinend hatte sie ihm im Halbdunkel einen mächtigen Tiefschlag in den Unterleib verpasst. Kalkarib wollte aufspringen, ihr helfen, doch der Wachmann stürzte unglücklich, samt des Gewichts seines Kettenhemds, auf seine Beine und sofort schoß ihm gellender Schmerz bis hoch in den hinteren Rücken, der ihn kurzerhand betäubte. Um ihn herum brach ein Tumult aus, den er aufgrund der betäubenden Schmerzen nicht richtig wahrnahm und erst, als er wieder zu sich kam, blickte er zur Tür, wo er sah, wie drei Wachen die betäubte Belzora aus dem Raum schleiften. Kalkarib setzte sich mühevoll auf. Es war zu spät, um zu helfen. Niemand anderes im Raum hatte die Initiative ergriffen, sie alle kauerten sich so dicht sie konnten an die Wände, denn hier war jeder sich selbst der nächste. Der Jüngling verließ als letzter die Kerkerzelle, und trug, und das war für Kalkarib Genugtuung genug, Furcht in den Augen und einen filigranen Dolch in den zittrigen Händen. Also war es eben doch nur ein Kind in feinen Stoffen, dem man zu viel Macht gegeben hatte. Erst, als das Schloss wieder zugeschlossen und es finster in der Zelle war, wurde sich Kalkarib wirklich bewusst, was gerade geschehen war. Belzora, seine einzige Verteidigungslinie und die starke Anführerin des Zellenaufstands war soeben, wegen ihm, aus der Zelle abgeführt worden und somit Opfer ihrer eigenen Worte. Denn sie war es selbst, die wollte, dass es keinen Aufstand gibt, egal wer heute geholt wird. Noch ehe die Stimmung in der Zelle kippte, musste jemand etwas tun und dieser jemand war Kalkarib.
Teil VI – Sehnsucht nach Geborgenheit

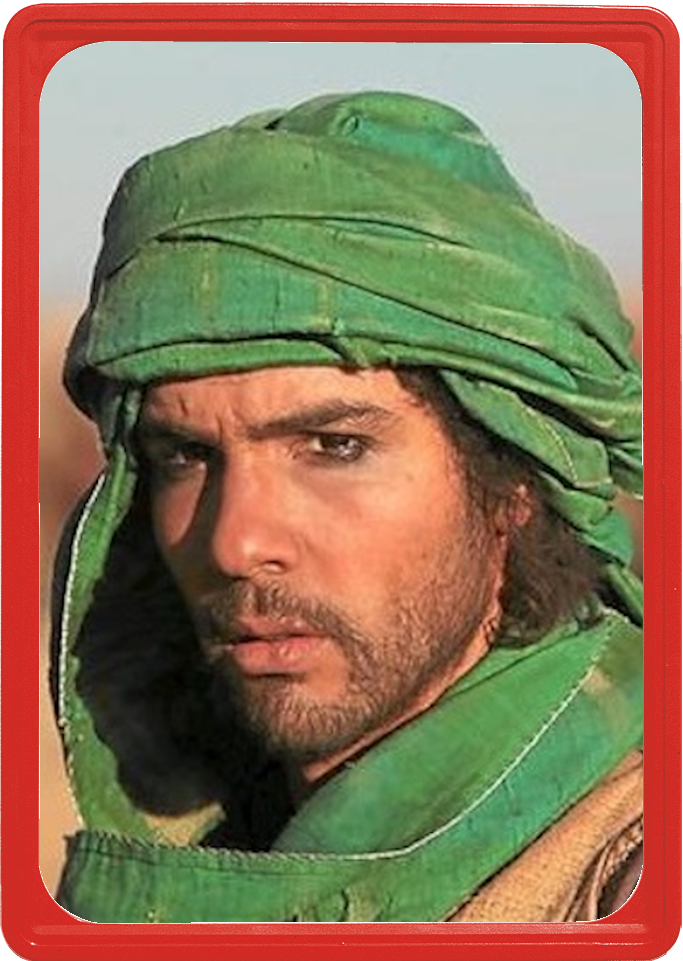
Kalkarib
al’Hashinnah

Zeit – ein Begriff, über den sich Kalkarib noch nie so sehr Gedanken gemacht hatte, wie in den letzten Stunden. Laut Belzora war er nur ein paar Stunden, bevor er das erste Mal aufgewacht war, von seinen Peinigern in die Zelle geworfen worden. Da zu der Zeit noch Licht schien, lag die Vermutung nah, dass es noch der selbe Tag war, wie der, an dem er entführt wurde, sicher war er sich jedoch nicht. Er lag wach, das Schwindelgefühl hatte ihn fürs erste verlassen, zumindest solange er ruhig dalag. Kein Licht drang mehr durch den schmalen Spalt, es musste irgendwann mitten in der Nacht sein. Um ihn herum lagen ein dutzend schnarchender Mitinsassen. Eng an Eng und sogar teils übereinander lagen sie auf dem harten Boden, der mit einer kaum erkennbaren Schicht altem und nassen Strohs bedeckt war. Dank Belzora hatte Kalkarib ein eigenes kleines Plätzchen an der Wand und musste nicht mit den anderen in den Körperkontakt gehen. Im Laufe des Tages hatte Kalkarib einen neuen Höhepunkt an Ekel in seinem Leben erreicht, als er schockiert mitansehen musste, dass der selbe Eimer, aus dem alle Menschen in der Zelle noch am Tage tranken, sich am Ende des Tages entleerten. Auch wenn er sich weggedreht und sich die Ohren zugehalten hatte, so wusste er, dass nur anderthalb Schritt von ihm entfernt ein Eimer voller menschlicher Ausscheidungen stand, den sie nicht einmal abdecken konnten und der deshalb den Raum in eine nicht erträgliche Stinkwolke hüllte, an die er sich zu seiner eigenen Beschämung inzwischen gewöhnt hatte.
Es war tief in der Nacht, während das Madamal einen schwachen Schein durch das schmale Fenster warf, als Kalkarib sich der vollen Tragweite seiner neuen Situation wirklich bewusst wurde. Er war in einem ihm unbekannten, nassen und kalten Kerker gefangen. Seine Peiniger hielten ihn für einen Anhänger Galottas und hatten ihn mit solchen eingesperrt. Er hatte keinen Beweis bei sich, der seine Worte hätte bekräftigen können, dass er eigentlich mit einem mittelländischen Ritter reiste und auf ihrer Seite stand. Er wusste nicht wie es Adellinde und Sieghelm erging, ob sie überhaupt noch am Leben waren und wenn ja, ob sie wussten in welche Not er geraten war und ob sie ihn aus dieser misslichen Lage befreien konnten. Kalkarib schämte sich dafür, aber im Moment war Sieghelm seine einzige Hoffnung auf Rettung. Auch wenn Kalkarib es nur ungern zugab, das Wort des Reichsritters hatte Gewicht in diesem Land und wenn er hier auftauchen und sagen würde: ‚Der dort gehört zu mir‘, dann würde Kalkarib entgegen jeglicher Vorsätze mit Freuden zustimmen und sich von ihm aus diesem Kerker befreien lassen. Im Stillen betete er zu Rastullah, dass er Sieghelm und Adellinde hierher führen würde, um ihn zu befreien. Er wusste nicht, wie lange er hier noch als Schaf im Wolfspelz das Spiel mitspielen konnte und ob sie ihm am Leben lassen würden, wenn herauskommt, dass er eigentlich auf der Seite des Mittelreiches stand. Wie sich das anhört, dachte sich Kalkarib. ‚Auf der Seite des Mittelreichs‘ – er hätte nie von sich gedacht, dass er einst so denken würde. Doch hier im Kerker gab es nur ein ‚die‘ oder ‚wir‘. Er wog seine Chancen ab, ob er Belzora erklären sollte, dass er eigentlich nicht zu Dschafars Truppen gehörte, sondern einfach nur ein Mann aus Mhanadistan war. Doch auf die Frage, was im Rastullahs Namen ein Novadi dann während des Krieges hier zu suchen hatte, fiel ihm keine wasserdichte Antwort ein. Also musste er die Maskerade vorerst weiterspielen, denn ihm bleib keine Wahl – zumal er so den Vorzug hatte, dass solange er es mitspielte, Belzora ihre schützende Hand über ihn hielt. Zumindest solange er noch angeschlagen war, musste er mitspielen, auch wenn sich damit die Entschuldigungen an Rastullah nur noch weiter häuften. Er vermisste seinen Gebetsteppich, zu gerne würde er nun zum Alleinen beten, um auf diese Weise ein wenig Ruhe und Einklang finden zu können. Doch seine Peiniger hatten ihn ihm genommen. ‚Was sind das nur für Unmenschen?‘, fragte er sich und verfluchte sie dafür, dass sie ihm nicht mal seinen Gebetsteppich gelassen hatten. Selbst in den Kerkern in Mhanadistan ließ man den Gefangenen ihre Teppiche – denn niemals würde ein anständiger Novadi auf die Idee kommen, damit etwas anderes anzustellen, als ihn für das Gebet zu nutzen.
Plötzlich hörte Kalkarib Schritte, die der Kerkertür näher kamen. Aus seinen Gedanken gerissen lauschte er ihnen. Es waren mehrere Personen und sie hielten direkt vor ihrer Kerkertür an. Durch einen sehr kleinen Schlitz in der Tür fiel Fackellicht ins Innere des Kerkers. Kalkarib überlegte, ob er sich vorsichtig hinstellen sollte, um mit den Kerkermeistern zu reden und sich zu erklären. Doch egal wie leise er zu Ihnen sprechen würde, die anderen im Raum würden seine Worte zweifelsohne mitbekommen und die Maskerade hätte ein jähes Ende. Also blieb er liegen, so wach wie man nur sein konnte, denn er verspürte Angst vor dem, was er jetzt kommen mochte. Die Tür wurde aufgesperrt und geöffnet, während das Kerkerinnere nun durch das Fackellicht in Gänze erhellt wurde, wurden seine Mitinsassen zum Teil wach, hielten sich die Hände vor die Augen oder drehten sich weg. Kalkarib blinzelte vorsichtig, um zwar sehen zu können was passierte, aber um nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Von seiner Position aus konnte er zwei bewaffnete Wachen ausmachen, die sich in ihm unbekannten Wappenröcken in die Tür schoben. Zwischen ihnen stand ein junger, gerade einmal fünfzehn Sommer zählender Bursche mit neugierigem Blick. Seine Kleidung war ungewöhnlich fein und verziert, seine Stiefel so sauber, dass sich der Fackelschein darin widerspiegelte und sein Gürtel war mit mehreren golden glänzenden Beschlägen punziert, auf denen ein Vogel in verschiedenen Positionen zu sehen war. Kalkaribs Blick fiel auf seine Dolchscheide an dessen Gürtel, in dem ein ebenfalls verzierter und silberner Dolchgriff steckte. Der Junge sah sich neugierig im Kerker um. War er etwa so jemand wie Sieghelm, der nun jemanden, der auf unglückliche Weise hier gelandet war, befreit? Zumindest war dies Kalkaribs erster Gedanke. Der Bursche deutete auf einen Mitgefangenen. „Den das“, sagte er in freudiger Erwartung. Offensichtlich hatte der Busche jemanden wiedererkannt, was Kalkaribs zweiter Gedanke war. Doch als die Wachen den Mann laut protestierend, wimmernd und unter lautem Hilfegeschrei aus der Kerkerzelle schleiften, verwarf Kalkarib seine beiden Gedanken. Alle anderen Insassen sahen hilflos zu, selbst Belzora tat nichts, als der Mann Anfang zwanzig unter offensichtlicher Todesangst aus der Zelle gezerrt wurde. Als die Kerkertür wieder ins Schloss fiel und abgeschlossen wurde, kehrte zuerst keine Stille ein. Der entführte heulte und schrie noch eine Weile – doch die Stimme entfernte sich und irgendwann endete sie abrupt. In der Kerkerzelle war schon vor der Tat eine bedrückende Stimmung, doch nun konnte Kalkarib förmlich spüren, wie sich Angst und Verzweiflung noch tiefer in die Seelen der Männer und Frauen brannte. Kalkarib lag noch eine Weile wach, denn er zermarterte sich den Kopf, was mit dem Gefangenen wohl passierte. Wurde er verhört? Wurde er gefoltert? Oder beides? Wenn er solche Angst hatte, dann war es nicht das erste Mal, dass das passierte und konnte es auch ihn treffen? Was wenn sich die Kerkermeister entschieden IHN rauszuholen? Zumindest wäre er dann mit ihnen alleine und konnte ihnen, ohne Angst enttarnt zu werden, seine ganze Geschichte erzählen – doch würden sie ihm glauben schenken? Zweifel nagte an Kalkarib, und die Angst, hier in der Kerkerzelle sein Ende zu finden, stieg in ihm auf. Er würde sein hübsches Weib und seinen liebevollen Sohn nicht mehr wiedersehen, zudem würden sie in der Ungewissheit leben müssen, was mit ihm passiert war, denn niemand – nicht einmal Sieghelm – konnte wissen, was mit ihm passiert war. Er wusste schließlich selber nicht, wo er sich befand. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass sie ihn aus einer misslichen und hoffnungslosen Situation befreiten. Kalkarib gab die Hoffnung nicht auf, dass er hier lebend rauskam, er wusste nur noch nicht wie.
Am nächsten Morgen, als die Kerkermeister den Eimer gegen einen – so hoffte er es zumindest – frischen Eimer mit Wasser tauschten, machten sich erstmal alle über das kühle Nass her. Belzora hatte den Wächter tatsächlich gefragt, ob sie für ihren Novadifreund eine Extraschüssel hätten, da er wie sagte wegen seines Glaubens, eine eigene Schüssel bräuchte, was die Wache jedoch verneinte. Kalkarib hatte das mit der Schüssel wegen der Ereignisse der Nacht schon vergessen gehabt, weshalb er umso verwunderter war, dass sich die blonde und kräftige Frau am nächsten Morgen daran erinnerte. Kalkaribs Schwindelgefühl wurde besser, und seine Verletzung am Bein schmerzte auch nicht mehr so sehr. Inzwischen war er sehr froh, dass eine fachkundige Heilerin und nicht er selbst sein Bein versorgt hatte. Rastullah allein wusste, ob es sich unter diesen Bedingungen wohl sonst entzündet hätte. „Geht es dir besser?“, erkundigte sich Belzora und reichte ihm eine Schüssel Wasser, damit er nicht selbst aufstehen musste. Neben ihr wirkte der schlanke Kalkarib wie ein Kind. Ihre Oberarme waren fast so groß, wie die von Sieghelm und ihre Schenkel waren so stark, dass sie damit bestimmt einen ganzen Baumstamm alleine anheben konnte. Kalkarib war immer wieder aufs Neue verwundert, wenn er sich mit ihr direkt neben sich verglich. „Es geht schon besser“, sagte er und trank etwas Wasser, das seinem rauen Hals guttat. Dann fasste er den Mut zu fragen: „Belzora, kannst du mir sagen, was in der Nacht passiert ist? Du hast es doch bestimmt auch mitbekommen.“ Sie lehnte sich gegen die Steinwand und starrte geradeaus. Ihr Blick wurde leer, als sie begann davon zu berichten. „Das geht hier schon seit dem Tag unserer Gefangenname so. Jeden Abend holt er einen von uns raus.“ Sie atmete tief durch und ihre Stimme wurde zittrig. „Manchmal hört man noch stundenlang danach Schreie und manchmal, so wie gestern, wird es schnell still. Keiner von ihnen ist bisher zurückgekehrt. Mögen die Götter über sie wachen.“ Der letzte Satz, den sie nachschob, verwunderte Kalkarib etwas. Erwähnte Sieghelm nicht, dass diese Leute die Dämonen anbeteten? Doch das war im Moment nicht wichtig. „Wer ist er … und wen holt er sich?“, fragte er, denn er wollte einschätzen, ob er es entweder beschleunigen oder verlangsamen wollte ‚ausgewählt‘ zu werden. „Wir sind hier auf Burg Rabenmund, ich dachte, das wüsstest du. Das ist die Stammburg der Familie und der Bursche, der jede Nacht zu uns kommt, ist der aktuelle Burgherr, da alle anderen seiner Familie fort sind – er kann also machen, wonach ihm beliebt.“ Kalkarib schluckte. Der Name Rabenmund sagte ihm etwas, er hatte ihn aus Sieghelms Erzählungen schon mal gehört und er glaubte, dass bei der Frühlingsturney auch welche dabei gewesen sein sollen. Es musste wohl eine bedeutende Familie des Mittelreiches sein, dachte er sich. Das erklärte ihm auch die Vogelmotivik am Gürtel des Jungen – es waren Raben. „Ich kann mich doch nicht an alles erinnern“, log der Wüstensohn und tat so, als würde er noch immer unter Gedächtnisverlust leiden. „Wo liegt diese Burg? Ist sie weit von …“ Dieses Mal hatte Kalkarib den Namen tatsächlich vergessen. „… ähm, diese Burg wo die ganzen Praiosdiener wohnen, entfernt?“ Kalkarib kam sich dämlich vor, er wünschte sich bei Sieghelms Erzählungen öfter zugehört zu haben. In seiner aktuellen Situation hätte es ihm geholfen, mehr über das Land und die Leute zu wissen. Es war jedoch seiner eigene Arroganz und Stolz geschuldet, dass er so gut es ging vermied, mehr darüber zu lernen, denn Kalkarib redete sich stets ein, dass er sich hier nicht lange aufhalten würde und es daher nicht notwendig war, so viel über das Land und die ganzen Adelsfamilien zu wissen. „Sprichst du von Burg Auraleth? Mensch, Kleiner – du hast ganz schön was abbekommen.“ Belzora knuffte ihn vorsichtig an der Schulter, doch auch ihr kumpelhafter Schlag war kräftig genug, um Kalkarib ins Wanken zu bringen. Als Kalkarib nickte, fuhr sie fort: „Die Stammburg der Rabenmund liegt etwa zwei Tagesreisen von Burg Auraleth entfernt.“ Kalkarib traf der Schlag: Zwei Tage?! Er war ganze zwei Tagesreisen von den anderen entfernt? Jetzt war er sich auch nicht mehr sicher, ob er noch am selben Tag im Kerker angekommen war. „Welcher Tag ist heute?“ Kalkaribs Stimme zitterte, als er die Frage stellte. Belzora blickte prüfend zum Fensterschlitz, wo die Sonne wieder den Eimer in der Mitte des Kerkers erhellte. „Heute müsste der 22. des Monats sein.“ Kalkarib versuchte sich seine Verzweiflung nicht anmerken zu lassen, doch in ihm zerriss etwas. Er wurde am Mittag des 18. entführt – zumindest nach der mittelländischen Zeitrechnung. Das bedeutete, dass schon vier Tage vergangen waren und da weder Sieghelm noch Adellinde hier aufgetaucht waren, konnte das nur bedeuten, dass sie entweder selber in einer Notsituation steckten, ihn noch immer suchten oder ihn für tot erklärt haben. Seine Hoffnung schwand von Moment zu Moment. „Hey Kleiner, mach dir keine unnötigen Sorgen.“ Sie knuffte ihn wieder freundschaftlich, anscheinend hatte er seine Verzweiflung nicht gut genug verborgen. „Ich habe schon einen Plan wie wir hier rauskommen“, flüsterte sie im verschwörerischen Ton und legte ein breites, gewinnendes Lächeln auf. Es war das erste Mal, dass er sie lächeln sah und zu seiner eigenen Verwunderung, sah sie unter der dicken Schicht aus Schmutz und Kratzern im Gesicht gar nicht so schlecht aus. Sie war zwar nicht wirklich sein Typ, aber wenn ihr blondes Haar gewaschen und ihr Körper und Gesicht gepflegt waren, würde sie bestimmt eine ansehnliche Frau sein. Ihr muskulöser Körper irritierte Kalkarib noch immer, denn er machte es ihm leichter sie anzusehen, da er immer wieder vergaß, dass sie eigentlich ein Weib war und er dabei jedes Mal gegen eines der 99 Gesetze verstieß. „Der gute Radromir dort hinten …“, fuhr sie leise fort und zeigte auf einen der Mitgefangenen auf der anderen Seite des Raums, „… kann das Schloss der Tür mittels Zauberei öffnen. Wir überwältigen dann die Wachen und fliehen von dieser verfluchten Festung.“ Als Belzora ‚die Wachen überwältigen‘ erwähnte, drehte sie ihre beiden kräftigen Fäuste übereinander in verschiedene Richtungen. Kalkarib war klar, dass sie mit dieser Geste meinte, sie töten zu wollen. Er hatte kein Problem damit, jemanden umzubringen, doch als ihm klar wurde, dass die Bewohner von Burg Rabenmund eigentlich diejenigen waren, auf deren Seite er stand, wurde ihm unbehaglich bei dem Gedanken. Er entschied sich daher für ein knappes: „Ich verstehe“, und trank den letzten Tropfen Wasser aus der Schüssel aus. „Wir …“, begann Beloza wieder und rücke noch etwas dichter an Kalkarib heran. So dicht, dass sie ihren muskulösen Schenkel auf seinen legte und er ihre Wärme spüren konnte. Sie Griff dabei mit ihrer kräftigen Hand nach seiner inzwischen bärtigen Wange und er spürte ihren heißen Atem an seinem Ohr: „ … werden es in der Nacht der toten Mada tun, und zusammen werden wir von hier entkommen.“ Kalkarib fuhr ein feuriges Kribbeln durch den Körper, als Belzora ihm so unangenehm und gleichwohl erregend nahe kam. Es war lange her, dass er das letzte Mal die Bettstatt mit Delia geteilt hatte. Er wusste nicht warum sich Belzora so sehr um ihn kümmerte und ihn beschützte, aber im Moment war es das Beste für ihn, das Spiel mitzuspielen. Als Belzora von alleine wieder von ihm abließ, drehte er sich zur Seite und blieb noch eine Weile so liegen, denn er spürte eine lange nicht mehr gefühlte Erregung, und das obwohl dieser Ort nach allem stank, was menschliche Körper ausscheiden konnten und förmlich danach schrie, dass dies der schlechteste Ort auf ganz Dere war, um hier Erregung zu spüren. Kalkaribs Welt stand Kopf und er versuchte so stark er nur konnte an seine Frau, sein Kind und seine Heimat in El’Trutz zu denken, damit ihn seine animalischen Gedanken verließen. Er fühlte sich benutzt, beschmutzt, aber auch gleichzeitig so lebendig und beschützt, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
Teil V – Getrennt (3)


Sieghelm Gilborn
von Spichbrecher
Das Metall von Sieghelms Plattenrüstung schepperte mit jedem Schritt, den er durch das Unterholz tat. Auch wenn er schon so schnell lief, wie er konnte, so war er nicht schnell genug, denn die Untoten folgten ihm noch immer. Im Laufschritt ging er seine Optionen durch: Er konnte sich unterwegs seiner Rüstung nach und nach entledigen, um so an Gewicht zu verlieren und an Geschwindigkeit zu gewinnen, doch würde es ihn nur noch mehr anstrengen und am Ende würde er ohne Rüstung dastehen – was einer Todeserklärung gleich käme. Denn wenn nur ein einziger Hieb oder Pfeil durchkäme, wäre er ohne Verbandszeug nicht in der Lage, die Wunde zu versorgen. Er könnte auch einfach stehen bleiben, zu Atmen kommen und sich den Untoten stellen – zumindest wäre dies rondragefälliger. Doch die Untoten waren zahlreich, zu zahlreich. Auch wenn er ihre genaue Anzahl nicht kannte, er hatte an die drei Dutzend von ihnen gesehen und er wusste nicht, wie viele da noch waren, die er nicht erblickt hatte. Ihre schiere Anzahl machte es unmöglich, denn er war allein und hatte nicht mal ein Schild dabei. Auch wenn es den sicheren Tod bedeutete, so war es zumindest eine Option, die Sieghelm nicht gänzlich aus seinen Gedanken verbannte, denn so würde er wenigstens einen ehrenhaften Tod finden. Nur das ihm der Gegner, der Ort und der Zeitpunkt missfiel. Er musste an den heiligen Hlûthar von den Nordmarken denken, dem Träger des legendären Schwerts Siebenstreich. Auch er starb im Kampf, in einem Kampf an einem Ort und Zeitpunkt, den er sich mit Sicherheit anders vorgestellt hatte. Doch der Heilige der Rondrakirche verstarb auf dem Feldherrenhügel, im Beisein vieler Mitstreiter im Kampf gegen eine Übermacht aus Dämonen, und nicht einsam in einem unbekannten Waldstück gegen ein ‚paar‘ nieder Untote. Den Heldentot, den sich Sieghelm wünschte, stellte er sich anders vor. Also lief er weiter, rannte über Stock und Stein und suchte nach weiteren Optionen. Doch schon bald würde ihm die Puste ausgehen und er würde schlichtweg umfallen. Er nahm sich fest vor, dass er, bevor das passierte, stehen blieb und sich seinem Schicksal stellte. Noch immer hörte er das Rumoren und Gestöhne der zahllosen Untoten hinter sich, die zwar selbst auch nicht die schnellsten waren, aber da er immer langsamer wurde, holten sie allmählich auf.
Er wusste nicht wie viel Zeit verging und wie lange er durch das Unterholz rannte, ihm kam es wie eine Ewigkeit vor und der Wald wollte einfach nicht enden. In der Entfernung sah er, dass das Gebiet vor ihm hügeliger wurde. Er hoffte dort zu finden wonach er suchte: Eine Höhle. Er brauchte einen Engpass, wo er den Vorteil der Untoten zu seinen Gunsten ausgleichen konnte, wo sie ihm nur einzeln oder zu zweit entgegen treten konnten. Er hoffte, ja flehte in Gedanken um eine wie auch immer geartete Höhle. Die Hoffnung auf einen zu verteidigenden Engpass ließ ihn wieder etwas Hoffnung schöpfen, auch wenn er schon starke Belastungsschmerzen in den Beinen hatte und seine Brust sich anfühlte, als würde dort ein Feuer brennen. Er spürte, wie sich sein Gambeson mit kalten Schweiß füllte und hörte seinen eigenen, immer hektischer werdenden Atem. Er kraxelte um eine Anhöhe, und blickte hoffnungsvoll auf die mehrere Schritt fast vertikal verlaufende Erdschicht, doch außer herausstehenden Wurzeln und einem leichten Überhang war dort nichts, was sich für seinen Plan eignete. Das Gegurgel und Gestöhne der Untoten, die mit jedem Lidschlag an Nähe gewannen, schallte wieder zu ihm herüber. Strauchelnd und stolpernd eilte Sieghelm zu einer anderen Stelle in der Nähe, einem ausgetrockneten Flussbett. Unterwegs verhakte sich sein Schwert in der Scheide in einem Ast, wodurch er wertvolle Zeit verlor, da er es fallen ließ und mühsam ein paar Schritt zurückgehen musste, um es aufzuheben. Er konnte die Schaar untoter Schergen hinter sich schon sehen, sie waren noch nur noch etwa zwanzig Schritt von ihm entfernt. Er erreichte das ausgetrocknete Flussbett und eilte stets zu den Seiten blickend, die Hoffnung nicht aufgebend irgendwo eine Höhle zu sehen, erschöpft entlang. Ihm rannten die Untoten noch immer hinter her, auch sie stolperten und fielen, doch unermüdlich erhoben sie sich immer wieder und rannten ohne langsamer zu werden weiter. Er rannte so schnell ihm seine erschöpften und ermüdeten Beine trugen. Er machte hunderte, da vielleicht sogar tausende Schritt, da hörte Sieghelm eine innere Stimme, die ihm sagte, dass er stehen bleiben und sich dem Kampf stellen sollte, da keine Höhle kommen würde. Er war bis in alle Maßen erschöpft, doch einfach nur umfallen und sich den Untoten als Futter hingeben wollte er auch nicht. „Bleib … stehen“, keuchte er in seinen Helm hinein und spuckte dabei erschöpft aus. Er musste es seinen Beinen befehlen und er blieb stehen. Er hörte das freudige Stöhnen der Untoten, in der Erwartung, sich gleich an seinem Fleisch laben zu können. Doch so leicht würde der kampferfahrene Reichsritter und Ordensmeister es ihnen nicht machen. Er atmete zwei Mal tief durch, doch eine Brust brannte noch immer. Die Bedingungen waren mehr als ungünstig für einen Kampf gegen eine Überzahl niemals erschöpfender Gegner, doch er hatte keine andere Wahl, also stellte er sich ihr. Er hatte nicht einmal mehr genügend Atem für ein Gebet an Rondra, weshalb er es nur in Gedanken durchging. Er drehte sich um, holte Custoris aus der Scheide und schleuderte selbige zur Seite. Seine Arme waren noch kräftig genug und so schloss er seine Hände um den Griff und hob das Schwert an. Das Leder des Griffs ächzte, so fest packte er es. Ihm rannten, stolperten und torkelten an die dreißig Untote entgegen, die so ausgehungert waren, dass sie sich teils gegenseitig wegdrückten, um ja der erste am Kriegerbuffet zu sein, und die dreißig Untoten waren nur die, die Sieghelm sehen konnte. Sie kamen das Flussbett entlang und über die Hügel herab und Sieghelm stellte sich ihnen für einen finalen Kampf.
Durch den Wald dröhnte nicht verhallender Donner, denn Sieghelm schwang Custoris so schnell er konnte und mit jedem Schwung fuhr es mühelos durch weiches, untotes Fleisch. Die Wellen der Wiedergänger brandeten an Sieghelms nicht endenden Schwertschwung und ihre geschundenen Körper wurden in Stücken und Fetzen zu den Seite des Flussbetts geschleudert, teilgeronnenes Blut spritzte in Fontänen auf den matschigen Boden und das alte Flussbett füllte sich mit Blut. Sieghelm machte dabei langsame und vorsichtige Schritte rückwärts, um immer genügend Distanz zu den Untoten zu bekommen und um nicht zu stürzen, denn es war ihnen vollkommen gleich, ob sie getroffen wurden oder nicht, sie gierten nur nach warmen, lebendigen Menschenfleisch und ließen sich dabei nur von der Klinge des heiligen Anderthalbhänders aufhalten. Der Reichsritter hinterließ eine Schneise aus zerfetzten Körpern, während die Traube um ihn herum immer größer wurde und er immer schneller und unvorsichtiger nach hinten gehen musste, um ihren nach Fleisch gierenden verfaulten Händen entkommen zu können. Sieghelm erreichte eine Stelle, bei der die ehemalige Flussböschung zu seinen Seiten fast so hoch war wie er selbst. Einer der Untoten nutze den Höhenvorteil und sprang von dort direkt zu ihm herab. Seine Ausweichbewegung kam zu spät, der Untote prallte mit voller Wucht gegen ihn und krallte sich mit seinen Händen an seiner Rüstung fest, wodurch Sieghelm ins Straucheln kam und rücklings stolperte. Das Gleichgewicht verlierend, fiel er unter der Last der Untoten, die die Gelegenheit nutzten und sich auf ihn stürzten, nach hinten. Der bisher niemals endende Rondradonner endete abrupt, als Sieghelms Rüstung beim Sturz metallisch aufheulte. Er lag am Boden, war vollkommen erschöpft und auf ihm lagen hungrige Untote, die ihre verfaulten Finger gierig unter seine Rüstungsteile schoben, um ihn gleich in Stücke zu zerreißen. In einem letzten verzweifelten Akt packte er Cursoris mit der einen Hand an der Fehlschärfe und mit der anderen am Griff, um mit der Parierstange zuschlagen zu können. Er blickte durch seinen schmalen Sehschlitz des Helms hindurch und rammte die Parierstange in die weichen und teils augenlosen Köpfe der Untoten direkt über sich. Sie fielen regungslos auf ihn und schränkten ihn noch weiter ein, aber Sieghelm freute sich über jeden Untoten den er noch vernichten konnte, bevor er gleich sterben würde. Es war nur seiner metallenen Ganzkörperrüstung zu verdanken, dass die Untoten nicht ihre Zähne in Sieghelm treiben konnten, denn jede noch so kleine Stelle an seinem Körper war mit mindestens einer Schicht Metall bedeckt. In dem Helm hörte Sieghelm nur noch sich selbst, wie er knurrte, als er sich dem Ende nah seinem Überlebensinstinkt hingab. Er schlug mit der Parierstange zu, schlitzte, mit der Klinge in der Halbhand gehalten, Köpfe auf und rammte mit der Spitze seines Eisenfußes Brustkörbe und Bäuche ein. Kaltes, dickflüssiges Blut floss auf seinen Helm und tropfte durch den schmalen Sehschlitz hindurch in sein Gesicht, was ihm zu allem Überfluss noch die Sicht nahm. Nun hörte er nur noch das Schlitzen und Zerreißen von Fleisch, das wilde und unartikulierte Gestöhnte der Untoten und ein von ihm selbst kommendes alles übertönendes lauter werdendes Knurren. Plötzlich brüllte er, er brüllte so laut er konnte und wollte aufstehen, er wollte hier nicht sterben, nicht jetzt, nicht hier und schon gar nicht so! Blind und erschöpft, brüllte er wie eine Löwe, schlug weiter und ließ all seine Glieder stets in Bewegung. Custoris biss zu, denn es war der Zahn Rondras und mit jedem Biss zermalmte es einen der zahllosen Wiedergänger. Sieghelm zwang sich die Augen zu öffnen, sein Sichtfeld war verschwommen, ein blutroter Schleier hing darüber und seine Augen brannten – doch konnte er Silhouetten sehen und das musste genügen. Er schlug zu, griff Custoris wieder mit beiden Händen am Griff und hörte sich selbst, wie er aus voller Lunge und Kraft einen animalisch Brüll losließ. Er spürte nur noch Hitze in sich, in allen Gliedern, jeder seiner Muskeln war glühend heiß und arbeitete über jedes Limit hinaus. Er schlitzte und hackte, alles an ihm schmerzte, doch er konnte nicht anders, er wollte hier nicht sterben. Irgendwann ebbte das Stöhnen der Untoten ab und noch immer konnte er nicht richtig sehen, weshalb er auf alles einschlug das ihm zu nahe kam und sich bewegte – Custoris erledigte den Rest.
Später

Radulf & Vitus
Ackerknecht
Er hörte eine Stimme. Alles war schwarz. Dann wieder die Stimme. Rief sie ihn? Er spürte nichts. Kein Schmerz, nur Kälte. Unerträglich tiefe Kälte. War er tot? Fühlt sich so Golgaris Flug über das Nirgendmeer an? Dann wieder die Stimme, er hörte seinen Namen. Sieghelm? Warum rief ihn jemand? War es sein Vater, Parzalon? War er jetzt bei ihm, in Rondras Hallen? Wenn doch nur nicht diese Kälte wäre. „Sieghelm?“ Da war sie wieder, die Stimme. Er öffnete die Augen und sah Blut, dickflüssig Blut, das in den aufgeweichten Waldboden sickerte. Inzwischen war es dunkel geworden, die Dämmerung war über den Tag hereingebrochen und die Nacht senkte sich über den Wald. Er hockte am Boden, sah, wie er Custoris hielt, dessen Spitze er tief in den Boden gerammt hatte. Er befand sich in einer typischen Beterposition und seine Glieder waren eisigkalt, um ihn herum lagen Berge aus zerfetzten Untoten, aufgerissen und aufgebrochen. Knochen ragten abstrakt heraus, Bäuche waren geöffnet und verfaultes Gedärm lag blutig überall auf dem Boden verteilt. Ihre Schädel waren eingeschlagen oder abgetrennt, übersäht mit Kratz- und Schlitzspuren. „Ser Sieghelm, könnt ihr mich hören?“ Die Stimme war schüchtern und ängstlich. Sieghelm blickte durch seinen Helmschlitz hindurch auf und sah Flussbettabwärts etwa zehn Schritt von sich entfernt, über zerrisse Untotenkörper hinweg eine Gruppe aus Soldaten in verschiedenfarbigen Wappenröcken. Sie hatten ihre Waffen in ihren Händen und schauten alle besorgt, teils schon angsterfüllt drein. Ganz vorne erblickte er den ihm gut vertrauten schwarzsilbernen Wappenrock des Schutzordens der Schöpfung. Der Mann, der ihn ansprach und einen ungepflegten Drei-Tage-Bart trug, der ein eingefallenes Gesicht umrahmte, war Vitus Ackerknecht, Schützer des Ordens und ein ehemaliger Gardist aus Hochstieg. „Ja, kann ich, Vitus“, sagte Sieghelm, der selbst erstmal realisieren musste, dass er anscheinend noch am Leben war und nicht genau wusste, was geschehen ist und wie er in diese Pose gekommen war. Er versuchte sich zu erheben. Von einem Moment auf den anderen fuhr die Grimmkälte aus ihm und sein ganzer Körper war ein einziger durchdringender Schmerz. „Aaarrgh!“, entfuhr es ihm und sein Körper sackte zusammen und fiel scheppernd zu Boden. „Vitus!“, rief er noch, und das letzte, was er sah, war das besorgte Gesicht des Mannes, dass sich über ihn beugte und wie sich seine Lippen bewegten. Doch er konnte ihn nicht mehr hören, denn die Welt um ihn herum wurde dunkel.
Als Sieghelm das nächste Mal erwachte, befand er sich, seiner Rüstung entledigt, in einer breiten Bettstatt wieder. Ein Feuer knisterte wohlige Wärme verbreitend in seiner unmittelbaren Nähe in einem Kamin. Als er sich bewegen wollte, bemerkte er, dass er mehrere Verbände am Körper trug und seine Arme und Beine an mehreren Stellen schmerzten. Er stöhne bei dem Versuch sich aufzurichten. „Hey, ganz langsam!“, hörte er eine Stimme und versuchte herauszufinden, von wo sie kam. Er war in einem Haus, offensichtlich ein Bauernhaus, ausgestattet mit einfachen Möbeln. Auf einer Anrichte neben ihm stand eine Schüssel mit Wasser, daneben Verbände und eine Tasche mit Wundnähzeug. Zu ihm kam ein neues, aber ebenfalls altbekanntes Gesicht, dass zu Radulf Ackerknecht, dem Bruder Vitus‘ gehörte. Auch er trug einen zerschlissenen Wappenrock des Schutzordens und an der Schlaufe seines Gürtels hing ein Streitkolben. So wie sein Bruder, hatte auch er einen dichten braunen Bart bekommen und in seinen Augen lag die Müdigkeit eines Soldaten, der das Grauen gesehen hatte. „Ihr seid endlich wach, wie fühlt ich euch, Ser?“, erkundigte sich der Anfang dreißigjährige Schützer und ebenfalls ehemalige Korporal Hochstiegs. Sieghelm ging seine Körperteile einzeln durch und da er in jedem einen dumpfen Schmerz verspürte und sich kaum bewegen konnte, entschied er sich für: „Gut, noch ein wenig Taub, aber das wird schon.“ Sieghelm bemerkte, dass seine Stimme belegt war, so als hätte er die letzten Tage nichts anderes getan, als zu schreien. Radulf schmunzelte durch seinen dichten Bart hindurch. „Sehr gut, dann könnt ihr endlich aufstehen und euren Toilettengang alleine bewältigen“, scherzte er und provozierte seinen Herrn damit. „So weit würde ich jetzt nicht gehen“, antwortete Sieghelm knapp und ließ sich mit übertrieben schmerzerfüllten Gesicht zurück auf das Kissen sinken. „Was macht ihr hier?“, schob er noch hinterher und genoss die Wärme der Kohlenpfanne unter seiner Bettdecke. Radulf holte sich einen Schemel heran, und stellte ihn neben Sieghelms Bettstatt. Als er sich setzte strich er sich imaginäre Krümel vom Wappenrock, um etwas Zeit zu gewinnen, um sich seine Worte gut zu überlegen: „Wollt ihr, dass ich beim Marschbefehl in Hochstieg anfange oder soll ich erst nach dem Weltenbrand einsteigen?“ „Weltenbrand“, erwiderte der angeschlagene Reichsritter zackig. „Tja …“, begann der Schützer und schaute sich um, als ob er im an den Wänden nach Worten suchen würde. Dann begann er leise und fast schon im Plauderton zu berichten: „Wir sind aus Hochstieg mit einem Halbregiment, also 260 Mann aufgebrochen. Ich habe gestern das letzte Mal nachgezählt – und ich bin nicht gut in zählen – da waren wir 45, also knapp ein Banner voll.“ Sieghelm konnte nicht anders, als mit weit aufgeschlagenen Augen zum Schützer zu blicken. Er war schockiert. „Ein Banner? Ich bin mit 5 Bannern und einer Lanze in die Schlacht gezogen …“ Radulf hob hilflos die Arme. „Vielleicht haben noch mehr überlebt, das sind die, die wir nach dem Weltenbrand sammeln konnten. Vielleicht sind einige schon auf eigene Faust auf dem Rückweg oder schlagen sich noch alleine durch.“ Sieghelm atmete tief durch, die Nachricht schockierte ihn. Er versuchte sich an den Moment auf dem Mythraelsfeld zu erinnern. Er hatte gesehen, wie ein paar seiner Männer und Frauen fielen, aber kurz nachdem er Amagomer den Blutigen im rondragefälligen Zweikampf besiegt hatte, stand noch ein Großteil des Regiments auf den Beinen und war wohlauf. „Was ist mit den anderen Bannerführern? Lady Dankhild, Hagen, Jost und diese … diese … wie hieß sie doch gleich …“ Sieghelm schämte sich, ihren Namen vergessen zu haben und erinnerte sich an seinen Schwur, zukünftig jeden seiner kämpfenden Untergebenen beim Namen kennen zu wollen. „… die Anführerin des Warunker Freiwilligenbanners?“ Er rührte hilfesuchend mit der Hand in der Luft, denn mehr konnte er aufgrund der Schmerzen nicht. Radulf machte eine missmutige Miene. „Ich bin mir nicht sicher, ob ihr in eurem gegenwärtigen Zustand …“, setzte der Streitkolbenkämpfer besorgt an, doch Sieghelm schaute ihn missbilligend an, was ihn dazu brachte, seinen Satz selbst zu unterbrechen und erschöpft durchzuatmen. Radulf erhob sich auf seine Schenkel klatschend und ging zum Schrank, um dort etwas aufzunehmen. Er zeigte Sieghelm ein Kette mit Wolfszähnen daran. Mit trauriger und ruhiger Stimme begann er dann zu berichten: „Wir haben Jost auf dem Mythraelsfeld gefunden, er war seinen Verletzungen erlegen. Es muss schon während der Schlacht passiert sein. Diese Kette gehörte ihm.“ Sieghelm blickte traurig auf die Kette, er kannte Jost schon lange. Er war ein erfahrener Soldat und Bogenschütze. Jost, Hagen, Radulf und Sieghelm hatten zusammen an der Trollpforte gekämpft und geblutet, als Sieghelm noch ein Junker und Niemand war. „Lady Dankhild … nun wenn man es genau nimmt, wissen wir es nicht … als Kavallerie waren sie an einem anderen Ort auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Ich habe aber erst gestern mit einem Soldaten eines Wehrheimer Banners gesprochen, der meinte, dass er gesehen haben will, wie während des Weltenbrandes eine ganze Lanze Reiter mit unserem Wappen vom Boden verschluckt wurde.“ Radulf pausierte kurz, um das Erzählte sacken zu lassen. „Wir haben die Stelle natürlich abgesucht, aber außer einem großen Spalt im Boden … war da nichts, keine Pferde, kein Banner, kein Hinweis.“ Die beiden Männer fielen in betretenes Schweigen. „Und Hagen?“, brach der Ordensmeister dann die Stille. Hagen war sein treuester und erfahrenster Kämpfer, er war zwar ‚nur‘ ein Gemeiner aus dem Hause Kohlhütten, aber innerhalb des Ordens und aufgrund seiner Verdienste gestand Sieghelm ihm nach der Ordensgründung den Titel eines Schutzritters zu. Radulf atmete tief durch, er schien nicht zu wissen, wie er es sagen sollte. „Hagen … ja … das wissen wir auch nicht. Seine Leute berichten, dass er zu Beginn des Weltenbrandes noch stand, doch als es dann Feuer, Eis und zerstörende Magie regnete und sich der Boden unter unseren Füßen auftat … ward er nicht mehr gesehen. Wir wissen es nicht“, gab Radulf offen zu und war den Tränen nah. Auch Sieghelm war geschockt. Hagen Kohlhütten gehörte zum Siebenerrat in Hochstieg und war sein persönlicher Berater. Er kannte ihn schon, als er noch ein kleiner Junge war. Radulf wischte sich durch das Gesicht, als würde er sich Dreck aus dem Gesicht wischen, um zu verdecken, dass er ein paar Tränen verdrückte. „Achja …“, setzte er dann mit schwacher Stimme an, „Ilene aus Warunk, die Bannerführerin der Freiwilligen hat auch überlebt, sie … ist gerade unterwegs und klappert gerade einen anderen Hof ab, in der Hoffnung, dort noch Überlebende zu finden.“ Sieghelm nickte nur, es war nur ein schwacher Trost, er kannte sie nicht und er ertappte sich dabei wie er sich wünschte, dass er Hagen jederzeit gegen sie eintauschen würde. Denn der Krieg hatte ihn soeben mehrere seiner langjährigen Freunde und Wegbegleiter genommen.
Teil V – Getrennt (2)


Adellinde
Peraine-Priesterin
Ihre Brust brannte, als sie immer wieder nach oben schaute und die Zinnen von Burg Auraleth näherkommen sah. An oder hinter den Mauern der Praiotenfeste würde sie mit Sicherheit Schutz finden. Oder vielleicht sogar Verstärkung. Ihre Tränen über den plötzlichen Verlust von Hagen hatte sie inzwischen weggewischt, doch noch immer schmerzte sie seine Opferung. Er hatte ihr damit Zeit verschafft, um sich außerhalb der Sichtweite der Untoten zu bringen, aber dennoch gab er sein Leben für ihres – was sie schmerzte. Während sie immer weiter rannte und sich von Baum zu Baum versteckte, um sich immer wieder Mal kontrollierend umzusehen, musste Sie an das Gespräch mit Hagen denken. Sie hatte ihn dazu gebracht sein Handeln zu hinterfragen und für einen kurzen Moment hatte sie eine Verbindung gespürt. Auch wenn der Mann aus Waldsend schmutzig, schäbig und stinkend war, so war unter der Kruste nur eine verirrte Seele, die nach Halt suchte. Und Adellinde gab ihm wieder Halt – nur das eben dieser Halt ihn geradewegs in die Arme Borons getrieben hatte.

Hagen von Föhrenstieg
Orden vom Bannstrahl Praios
Adellinde erreichte mit dreckigem Saum an der grünen Geweihtenklufft die erste Außenmauer von Burg Auraleth, der schon vor langer Zeit geschliffene erste Festungsring hatte zahlreiche Breschen. Sie waren so groß, dass darin Büsche und Bäume wachsen konnten. Sie kletterte über die mit Moos und Erde überwucherten Steine und lief weiter zum zweiten Festungsring. „Hilfe!“, rief sie außer Atem, doch niemand schien zu antworten. Sie erreichte den zweiten Festungsring, doch auch dieser hatte alte Breschen. Als sie erneut über Steine kletterte, sah sie im Innenhof des zweiten Festungsrings mehrere Leichen liegen. Sie erkannte die weißgoldenen Farben von Geweihten des Götterfürsten und einige Akoluthen – aber auch mehrere zerfetzte Gestalten, die wohl du Galottas Truppen gehört haben müssen. Anscheinend hatte hier vor kurzem ein Kampf stattgefunden und niemand hatte es geschafft die Leichen ordentlich beiseite zu schaffen, geschweige denn sie zu bestatten. Sie blickte hoch zu einem der rauchenden Türme und sendete ein kurzes Stoßgebet zu Praios, dass jemand auf der Festung überlebt haben möge. „So helft mir doch, bitte!“, rief sie wieder, und ihre Stimme überschlug sich, da sie noch immer außer Atem war.
Auf einer Anhöhe gelegen, erblickte sie einen weiteren Festungsring, der jedoch Intakt zu sein schien, nach links und rechts sah sie nur hohe Mauern. Auf den ersten Blick schien Festung Auraleth standgehalten zu haben. Sie erspähte einen Aufweg, zu dem sich immer wieder stolpernd und teilweise kletternd hoch bewegte. Mit schmutziger und zerschlissener Robe erreichte sie den breiten Weg und entdeckte endlich einen der Eingänge zur Festung. Die Tore waren geschlossen und hinter den Mauern stieg dichter Rauch auf. Sie stellte sich erschöpft vor das Tor, wischte sich an ihrer Robe das Gesicht trocken und holte nochmal Luft: „Im Namen des Herrn Praios, hört mich jemand!“, brüllte sie so laut sie konnte. Sie hoffte inständig, dass hinter den Mauen sich noch jemand befand, der ihr wohlgesonnen war. Wenn Festung Auraleth besetzt war und Galottas Schergen herausstürmen würden, hätte Sie nicht mehr die Kraft erneut zu fliehen. Ihre Beine zitterten und ihre Hände waren ganz kalt. Sollten die Götter entscheiden, wie es nun weiter geht, dachte sie sich schicksalsergeben. Tatsächlich öffnete sich eine kleine Pforte in dem mächtigen Tor und ein älterer Mann mit grauem Bart, Kettenhemd und weißem Wappenrock lugte heraus. „Bei den Zwölfen, welch eine Freude euch zu sehen – ich bin Hüterin der Saat Adellinde, ich komme in höchster Not, bitte lasst mich rasch ein!“, stellte sie sich zügig vor und trat näher. Doch als der Mann seinen Schwertknauf nach vorne schob und mit einer Hand daran rumfingerte, blieb sie in respektvollen Abstand stehen. „Dem Himmelrichter zum Gruße, ich bin Hermann der Pförtner – beweist mir zuerst eure Worte, bevor ich euch einlasse!“ Die Antwort des Pförtners verwunderte Adellinde, sie hatte nicht erwartet sich ‚beweisen‘ zu müssen, schon gar nicht vor einem Praioten. Zumal sie auf Anhieb nicht wusste, wie sie das hätte anstellen sollen. „Ähm … wie stellt ihr euch vor, soll ich das tun? Ich bin eine bescheidene Dienerin der Hüterin des Lebens, ich führe nichts von Wert bei mir – ich habe nur meine Robe, mein Glauben und mein Wort.“ Der Pförtner musterte sie. Als sie seine prüfende Blicke auf ihrer dreckigen und zerschlissenen Robe spürte, wurde ihr ein wenig unbehaglich. Sie wünschte sich eine saubere und neue Robe her, am liebsten sogar ein heißes Bad, doch die Umstände machten es ihr unmöglich. Als Hermann der Pförtner zu einer Antwort ansetzte, kam sie ihm zuvor und machte dabei einen mutigen Schritt nach vorne: „Hört zu, Hermann der Pförtner – ich habe nur mein Wort, und ihr seid ein Diener des Herrn des Lichts, der die Wahrheit erkennt, wenn er sie sieht – ich könnte euch jetzt auf Anhieb mehrere Gebete an die Herrin Peraine rezitieren und sogar das ein oder andere Stoßgebet an unseren Götterfürsten, aber ich habe keine Zeit dafür! Ich reise mit dem edlen Reichsritter und Ordensmeister Sieghelm von Spichbrecher zu Hochstieg, dem ehrenwerten Sieger der Frühlingsturney – ihr habt bestimmt Kunde davon bekommen. Seine Exzellenz ist in der Nähe und in größter Not, er benötigt sofort eure Hilfe – denn er stellt sich da draußen tapfer gegen die untoten Horden Galottas, die ihr versäumt habt von eurem Land zu tilgen! Und nun lasst mich ein!“ Mit jedem Satz, den sie rausfeuerte, wurde sie nicht nur schneller, sondern auch lauter und bestimmter. Am Ende stand sie kurz vor des Pförtners Nase und blickte ihn vernichtend an. „Hermann, lass die Geweihte ein“, dröhnte eine kräftige Männerstimme von Innen, woraufhin der alte Pförtner sofort demütig Platz machte. Adellinde schlüpfte mit einer kurzen Danksagung hindurch und stand plötzlich vor einer Gruppe aufgesattelter Reiter, angeführt von einem Mann mit rot vernarbten und teils verbundenen Gesicht, so dann man nur eins seiner Augen sehen konnte. Er trug auf seinen Kopf eine weiße Kappe auf der eine goldene Sonne gestickt war und dazu eine in der Praiossonne außergewöhnlich hell glänzende Rüstung mit gelbroten Praiossymbolen darauf. Seine erhabene und autoritäre Erscheinung wurde durch sein markant breites Gesicht und den frisch vernarbten Gesichtszügen noch unterstrichen. Instinktiv machte Adellinde eine leicht verneigende Geste vor dem Mann, der eine Gruppe aus vier weiteren Reitern anführte. „Ich bin Hagen von Föhrenstieg“, begann der Mann vom Pferd herunter mit lauter und anklagender Stimme zu donnern. „Beschirmer der Ordnung der Mittellande und Herr von Burg Auraleth, seit Hochmeister Rapherian von unserem Herrn höchstselbst abberufen wurde.“ Er machte eine kurze Pause um Luft zu holen und fuhr dann langsam mit noch anklagendem Ton fort: „Ihr besitzt eine laute und dreiste Stimme und führt noch dazu eine dreiste Anklage ins Feld … und das für eine Geweihte der gütigen Göttin.“ Adellinde, die sich das erste Mal seit Tagen wieder unter Geweihten befand, vergaß, dass sie es hier mit Praioten zutun hatte. Selbst unter anderen Geweihten, galten sie als herrschsüchtig und gelegentlich überheblich. Sie kramte kurz in ihrer inneren Bibliothek zu Titeln und Rängen und erinnere sich daran, dass ein Beschirmer dem Rang eines Ordensmeisters beim Orden des Bannstrahls Praios‘ gleichkam. Mit einer tiefen entschuldigenden Verneigung setzte sie noch einmal etwas leiser an: „Bitte verzeiht mir meinen unangemessenen Ton, eure Exzellenz. Es liegt mir fern Anklagen zu erheben. Erlaubt mir mich zu erklären. Ich bin aus Perz, mein Tempel dort wurde von Galottas Horden geschändet und geplündert, seine Wohlgeboren Sieghelm von Spichbrecher, hat mich dort gefunden und mitgenommen – seither reise ich mit ihm und helfe ihm bei seiner Queste seinen Vater, Baron Parzalon zu Dettenhofen wiederzufinden.“ Für einen Moment blickte Adellinde auf, doch aufgrund der blendenden Rüstung konnte sie ihn nicht allzu lange ansehen, weshalb sie wieder zum Boden schaute, der genauso aufgewühlt war wie sie. „Im Wald im Rahja, wurden wir von zahllosen Untoten überrascht und wurden getrennt. Er stellte sich ihnen tapfer entgegen, damit ich zu fliehen vermochte.“ Für einen kurzen Moment überlegte sie, ob sie von dem anderen ‚Hagen‘ erzählen solle, entschied sich aus taktischen Gründen jedoch dagegen. „Der ehrenwerte Reichsritter und Ordensmeister benötigt eure Hilfe, er steckt in größter Not und ihr seid seine und meine letzte Hoffnung, eure Exzellenz.“ Als Adellindes Schilderung endete, kehrte Stille ein. Sie schaute weiterhin zu Boden, denn sie traute sich nicht dem Mann in die Augen – bzw. in das Auge zu sehen. Sie hoffte die richtigen Worte mit dem richtigen Ton angeschlagen zu haben. Sie wusste, sie würden ihr schon nichts tun, aber sie musste sie irgendwie überzeugen. Da brach der Beschirmer mit lauter Stimme das Schweigen: „Ich kenne den Reichsritter. Er war vor kurzem hier auf Burg Auraleth.“ Jetzt konnte Adellinde nicht anders als verwundert zu ihm aufzuschauen. Zu dem Pförtner gewandt, redete er im Befehlston weiter: „Hermann, öffnet die Tore – wir reiten aus.“ Der alte Pförtner tat wie ihm geheißen, indem er in seiner Wachnische an einem Seil zog, das zum Mechanismus zum Öffnen der Festungstore führte. Ein ganz leises Klingeln war zu hören. Adellinde trat zur Seite, da sie den fünf Reitern Platz machen wollte. Sie war nicht sicher, ob der Beschirmer jetzt ausreiten wollte um Sieghelm zur Hilfe zu eilen, oder ob er ohnehin gerade in eine andere Richtung losreiten wollte. Über Adellinde und der Gruppe Bannstrahler ratterte der Mechanismus los, es knallte laut, als die Ketten auf Metall prasselten und das massive Fallgitter hochgehoben wurde, während der Pförtner zusammen mit vier anderen das Holztor aufstemmte. Als das laute Rasseln der Ketten verklungen war, ritt die Gruppe etwas vor und der Beschirmer hielt sein Ross direkt neben Adellinde an. Ohne sie anzusehen, fragte er sie: „In welche Richtung sagtet ihr, war der Reichsritter?“ Sie schaute auf und konnte von Nahen sehen, dass das Gesicht des Mannes vor kurzem verbrannt wurde. Seine Verbände waren frisch gewechselt, aber unter ihnen lag eine dicke Schicht Brandsalbe, um seine Verletzung zu lindern und die Heilung zu fördern. Adellinde wusste, dass er ungeheuerliche Schmerzen haben musste. Eine Verbrennung dieser Art und in der Größe, würde jeden normalen Menschen mit Fiber an die Bettstatt fesseln, doch Hagen von Föhrenstieg machte nicht den Hauch eines Eindrucks beeinträchtigt zu sein. „In Richtung Rahja, nahe eines Nebenarms der Gernat.“ Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, gab der Burgherr seinem Pferd die Sporen und alle fünf Reiter preschten unter lautem Hufengeklapper los. Sie zogen bei ihrem Ritt eine dicke Staubwolke hinter sich her, während Adellinde wieder das metallische Geschepper der Torkette hörte, als das Fallgitter herab gelassen wurde. Am liebsten wäre sie mitgekommen, doch das lag nun außerhalb ihrer Macht. Sie war in Sicherheit – vorerst. Und sie musste darauf vertrauen, dass es den Bannstrahlern gelang, Sieghelm und oder Kalkarib zu finden. Erst jetzt fiel ihr ein, dass Sie den Praioten nichts von dem jungen Novadi erzählt hatte, aber das war wohl auch besser so. Sie würden ganz bestimmt nicht wegen eines einzelnen unbedeutenden Novadis auch nur einen Finger krümmen, so viel wusste sie über die Anhänger des Ordens des Herrn Praios‘.
Adellinde beschloss näher zum Burgried aufzusteigen. Auch wenn sie nun schon die dritte Festungsmauer durchquert hatte, war sie noch immer nicht im Inneren Burgfried angekommen, es gab noch einen weiteren Verteidigungsring, den sie durchqueren musste. Sie nah nun endlich die Quelle der schwarzen Rauchwolke, die Praioten hatten die Leichen der Untoten und die der Toten Söldner und der anderen Geschöpfe aus Galottas Armee zu einem Haufen zusammengetragen und waren dabei, sie dem Feuer zu übergeben. Eine Gruppe Praioten zerrten die leblosen Körper von alten Handkarren und warfen diese auf den großen brennenden Haufen, der höher war, als sie selbst. Adellinde bedeckte ihre Nase aufgrund des dabei entstehenden Gestanks. Doch dann hörte sie ein paar Schreie aus einem Pallas. Instinktiv ging sie hin und entdeckte in der breiten, an der Wehrmauer gelegenen Stallung ein hastig angelegtes Krankenlager. Dutzende, auf den ersten Blick nicht zählbare Mengen an Verletzten, Versehrten und Kranken lagen auf Strohlagern quer und teils schon übereinander verteilt in der Scheune. Sie ging hinein und jeder Dritte griff nach ihr, rief nach ihr, schrie oder wimmerte leise. Es waren nicht nur Praioten, nein, es waren die unterschiedlichsten Leute, größtenteils Soldaten vom Feld, die es lebend vom Mythraelsfeld geschafft hatten, dachte sich Adellinde zuerst. Es waren jedoch auch Stadtbewohner und Bürger dabei. Dann fiel ihr wieder ein, das Wehrheim vom Magnum Opus zerstört wurde und es wohl auch Überlebende von dort waren. Jede ihr bekannte oder nicht bekannte Verletzungsart war vertreten und die Luft des Ortes war gefüllt von Schmerzensschreien und Hilferufen. Adellinde wankte ziellos durch die Scheune, flüsterte hier und dort Stoßgebete für die Verletzten, tupfte fiebernden Leuten die Stirn ab und taumelte dann ziellos weiter. Auch der ganze Pallas war gefüllt mit Verletzten und es gab viel zu wenig Fachkundige, die sich um sie kümmern konnten. Sie wusste nicht genau wie lange, aber sie verbrachte mehrere Stunden dort, kümmerte sich um die Verletzten, half Verbände anzulegen oder zu wechseln, improvisierte selber welche aus ihrem Unterkleid, wusch Wunden aus und stand dem einen oder anderen bei, als dieser zu Boron ging. Bis in den Praiosuntergang hinein blieb sie dort und arbeitete bis zur Erschöpfung. Als sie auf dem Hof des Pallas am Brunnen neues Wasser holte, lehnte sie sich kurz daran, um durchzuatmen, doch ihr Körper zollte Tribut für die harten letzten Tage und sie schlief binnen eines Lidschlags ein.
Teil V – Getrennt (1)

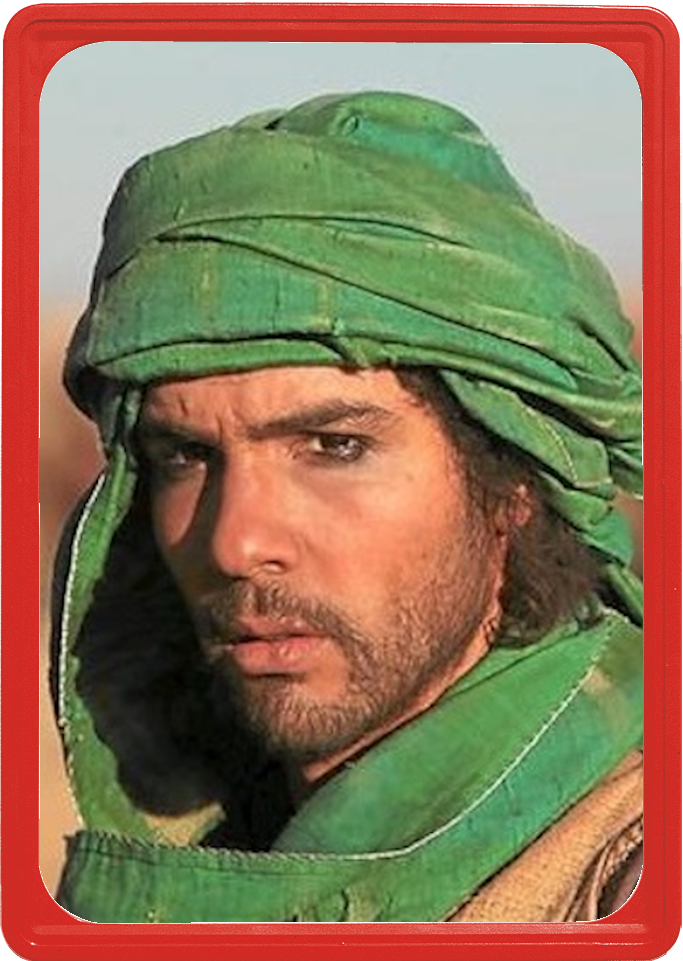
Kalkarib
al’Hashinnah
Schmerz. Schmerzen im Kopf, Nacken und in seinem verletzten Bein veranlassten den jungen Wüstensohn dazu aufzuwachen. Er blinzelte, rieb sich den empfindlichen Nacken und griff an seine Schläfe, wo er feuchtes, teils schon trockenes Blut ertastete. ‚Was war nur geschehen‘, fragte er sich und stellte fest, dass er auf einem kalten Strohlager lag, der Boden war feucht und die Steine darunter hart. Er musste in einem Gebäude sein. Als er sich umsah, bestätigte sich sein erster Gedanke: Graue, kühle Mauern umgaben ihn, er war in einem kleinen Raum, in dem nur durch einen schmalen Schlitz etwas Licht drang. Es gab nur einen einzelnen Lichtstrahl, der eine in der Raummitte stehende kleine hölzerne Schüssel erhellte. Kalkarib setzte sich auf. Sein Schädel brummte, als wäre er damit gegen eine Wand gerannt und er hatte Mühe, der Welt zu befehlen, sich nicht zu drehen. Erst jetzt bemerkte er, dass er nicht allein war, er teilte sich den kleinen Raum mit anderen Personen. Er erschreckte sich so sehr, dass er sich instinktiv, ja fast schon wie ein geschlagenes Tier, an eine der Wände zurückzog. Noch immer brummte sein Schädel und die Gestalten auf der anderen Seite des Raums saßen zusammengekauert im Schatten, weshalb er sie kaum erkennen konnte. Hastig suchte er einen Ausgang. Da war eine massive Holztür. Kalkarib nahm all seine Selbstbeherrschung zusammen, sprang an die Tür und war gewillt sie zu öffnen, doch fand er keine Klinke, keinen Griff, nichts. Innerlich verfluchte er das Mittelreich, was bauten sie nur für Türen, ohne Griffe? „Beruhige dich, Kleiner“, raunte eine weibliche, aber harte Stimme durch den kleinen Raum. Er fuhr herum, drückte seinen Rücken gegen die Holztür, doch die Geschwindigkeit mit der er die Drehung vollführte, ließ ihn wieder schwindeln, weshalb er die Quelle der Stimme nicht ausmachen konnte. „Setz dich, du hast ordentlich was abbekommen“, hörte er die Stimme fortfahren und aus den Gruppe von Personen löste sich eine Frau und trat in den schmalen Lichtstreifen, der durch sie unterbrochen wurde. Das Licht fiel von hinter ihr in den kleinen Raum ein, wodurch er zwar nicht ihr Gesicht, aber durchaus ihre Statur und Kleidung zu erkennen vermochte. Sie war sehr kräftig und ein langer, blonder Zopf hing ihr links über die Schulter herab und eine enge zusammengeflickte Lederkleidung umschmeichelte ihre muskulösen Rundungen. „W-Wer seid ihr, was wollt ihr von mir?“, brachte Kalkarib stotternd und mit seinem typisch novadischen Akzent hervor, doch das Reden schmerzte ihn, denn das Brummen in seinem Kopf versetzte ihm einen erneuten stechenden Kopfschmerz. Anstatt zu antworten legte die Frau nur ihre Arme in die Hüften, wodurch ihre beachtlichen Muskeln hervortraten. Kalkarib hatte noch nie eine so kräftige Frau gesehen. „Du hast ordentlich was auf den Kopf bekommen, Kleiner – setz dich lieber, bevor du noch umfällst.“ In der Stimme der Frau lag etwas Mütterliches, zudem hatte sie einen für Kalkarib unbekannten Akzent. Doch was viel vordergründiger war, war ihr klar erkennbarer Befehlston. Kalkarib, der Schwierigkeiten hatte, die Welt um ihn herum dazu zu bringen sich nicht zu drehen, tastete nach seinem Khunchomer – doch er war fort. Seine Hände suchten weiter, auch Delias Waggif, den sie ihm zu Beginn der Reise mitgegeben hatte,
war fort. Zu seinem Schwindelgefühl gesellte sich nun auch noch das Gefühl der Ohnmacht. Er ließ sich unter Schmerzen in seinem verletzten Bein an der Holztür zu Boden sinken. Er hatte keine andere Wahl, denn er war in einem Raum mit Fremden eingesperrt und wusste nicht wo er war, geschweige denn, wann er war. „As’Sali, hilf mir“, flüsterte er in seiner Muttersprache und der Schmerz in seinem Kopf holte ihn ein. Er sackte in sich zusammen und wurde bewusstlos.

Als er erwachte, lehnte er an einer anderen Stelle im Raum. Zu den Schmerzen in seinem Nacken und seinen Kopf gestellte sich nun auch noch Schmerzen in seinen Gliedern, zudem hatte er einen trockenen Mund – denn er hatte länger nichts mehr getrunken. Als er die Augen öffnete, sah er wieder nur die Holzschale in der Mitte des Raumes, die noch immer von einem Lichtstrahl erhellt wurde. „Ah, du bist endlich wach.“ Die Frauenstimme mit dem seltsamen Akzent befand sich direkt neben ihm. Er zuckte zusammen, als er bemerkte, dass die Frau neben ihm saß und wollte sich von ihr entfernen, doch auf der anderen Seite saß eine andere Gestalt an die selbe Wand gelehnt, so dass er nicht weiter konnte. „Wer seid ihr?“, fragte er und hielt sich den Kopf, als er fortfuhr: „Wo bin ich?“ Er glaubte die Frau mit dem Zopf neben sich grinsen zu sehen, denn aufgrund der anhaltenden Dunkelheit im Raum konnte er ihr Gesicht nicht richtig sehen. „Ich bin Belzora, und wir sind hier zusammen eingesperrt“, antwortete sie. „Was? Wo ist … argh.“ Kalkaribs Schädel explodierte vor Schmerz, als die Worte aus ihm herausplatzten. Es fühlte sich so an, als hätte jemand seinen Schädel mit einer Axt gespalten. „Ruh dich aus, ich kümmern mich um dich“, hörte er sie sagen, als ihm wieder so schwindelig wurde, dass er ein aufsteigendes Übelkeitsgefühl verspürte, doch außer Würgelauten, die seinen Kopfschmerz verschlimmerten, kam nichts über seine Lippen. Erneut holte die Dunkelheit Kalkarib ein.
Er träumte von seinem Weib und Kind. In seinen Gedanken war er bei ihnen, hielt seinen Sohn im Arm und befand sich Zuhause in El’Trutz, im Beisein seiner Sippe. Er vermisste sie. Er war schon viel zu lange von ihnen getrennt. Wieso hatte er sich nur dazu überreden lassen, dem arroganten Ritter zu helfen? Was ging ihn dieser Krieg dieses fremden Reiches überhaupt an? Er hatte ein wunderschönes Weib, so schön wie die Nacht, einen Sohn, so kräftig wie ein Löwe, und eine Familie, so groß wie seine Liebe zum Alleinen selbst. Oh wäre er jetzt doch nur bei seinem Weib, könnte sich an ihren Busen drücken und sie liebevoll umarmen, um ihre Wärme zu spüren und in sich aufzunehmen. Er war ein wärmeliebender Sohn der Wüste und sollte bei ihr sein – nein falsch – SIE sollte bei IHM sein. Dieses unheilige Gleichberechtigungsgefasel der Ungläubigen hatte ihn mürbe gemacht. Schon sein Bruder Mehmet hatte ihn vor den Ungläubigen gewarnt. „Lass dich nicht mit Ihnen ein, denn mit ihren spitzen Zungen machen Sie dich schwach!“, hatte er stets gesagt. In seinen Träumen war Kalkarib wieder ein El’Trutz und half zusammen mit seinem Bruder in der Karawanserei. Während Mehmet, als Erstgeborener zum neuen Karawanenführer ausgebildet wurde, wurde Kalkarib – als Zweitgeborener – der Umgang mit der Waffe gelehrt, denn er sollte einst unter der Führung seines Bruders die Heimstätte beschützen. Kalkarib war zufrieden mit seiner Rolle, denn As’Sali wollte es so, ansonsten hätte er ihn nicht zum Zweitgeborenen gemacht. Doch Kalkaribs Welt wurde zutiefst erschüttert, als Delia in sein Leben trat – seitdem ist er nur noch auf Reisen, auf der Flucht, verschollen in Raum und Zeit, entführt von einem Dämon oder in irgendeinem Kampf – doch in keinem für Rastullah, sondern immer nur in Kämpfen für andere und fremde Götter. Kalkarib hatte in der kurzen Zeit mehr erlebt, als so manch anderer in seinem ganzen Leben, zumindest war es genügend Stoff für eine eigene al’tarikh – eine Geschichte.
Als Kalkarib das dritte Mal erwachte, war sein Mund trocken, doch der Schmerz in seinem Schädel brummte nicht mehr so sehr, ihm war aber immernoch schwindelig und er war zu schwach, um sich von selbst zu erheben. Jemand hob sanft seinen Kopf an und legte ihm ein Gefäß an die trockenen Lippen. Als etwas Feuchtes seine spröden Lippen berührten, überkam es ihn, er sog es ein und schluckte es sofort herunter. Das Wasser schmeckte herrlich und er konnte nicht genug davon bekommen. Schluck für Schluck rann seine trockene Kehle hinab, während er schwindelig die Decke betrachtete. Als er jeden Tropfen genossen hatte, half ihm die Frau, die ihm zu trinken gegeben hatte, auf und setzte ihn gegen die Wand. Er genoss noch die kühle Feuchte in seinem Rachen, da sah er, wie die Frau, die Schale, aus der sie ihm zu trinken gegeben hatte, in die Raummitte in das Licht stellte. Es traf ihn wie ein Schlag, denn ihm wurde bewusst, dass aus dieser Holzschale alle hier anwesenden Personen tranken und nun auch seine Lippen diese Holzschale berührten. Ein sehr tief verwurzelter Ekel stieg in ihm auf, am liebsten wollte er das Wasser, das er eben getrunken hatte, sofort wieder ausspucken, doch sein Körper brauchte es zu sehr, als das er jetzt wieder ausspeien könnte. Seitdem er mit seinem Weib unterwegs war, aß und trank er nur aus seinem eigenen Essgeschirr, denn so wollte es sein Glaube. Er achtete auch akribisch darauf, dass keine Ungläubigen sein Essgeschirr berührten, auch wenn es sich nicht immer vermeiden ließ. Doch dann entschuldigte er sich beim nächsten Gebet dafür beim Alleinen und dann war es wieder gut. Da fiel es ihm ein, er musste bestimmt schon mindestens drei Gebete verpasst haben und zu allem Überfluss, wurde ihm sein Gebetsteppich ebenfalls genommen, As’Sali musste bestimmt schon wütend auf ihn sein. In Gedanken legte er sich schon verschiedene Entschuldigungsformulierungen zurecht, dafür dass er die Gebete verpasst hatte, dafür dass er von Geschirr getrunken hatte, dass Ungläubige berührt hatten, dafür, dass er nicht die Frau gemieden hatte und mit ihr Blicke gewechselt hatte, dafür, dass er sich nicht stets eines der 99. Gesetze im Geiste getragen hatte, dafür, dass … seine entschuldigenden Gedanken überschlugen sich und er wurde mitten in ihnen unterbrochen: „Gehörst du zu Dschafars Truppen?“, fragte die Frauenstimme neben ihm. Da Kalkarib aus seinen Gedanken gerissen wurde, hatte er sie nicht ganz verstanden. „Was?“ „Ich fragte, ob du zu Dschafars Truppen gehörst?“, wiederholte sie. Kalkarib wusste nicht, wovon sie da sprach. Er wollte es schon verneinen, da trat einer der anderen Anwesenden ins Licht, um sich die kleine Holzschüssel zu holen. Während er die Schüssel in einen Eimer daneben tunkte, um etwas Wasser herauszuholen, konnte er einen Blick auf den Mann erhaschen. Er war, so wie alle hier, in keinem guten Gesundheitszustand, bärtig und zottelig durch die mangelnde Möglichkeit der Körperpflege und trug mehrere Schichten verschiedenen Lumpen am Körper. Doch unter der Vielzahl der Lumpen entdeckte der Wüstensohn ein Zeichen, dass er von dem Mythraelsfeld nur zu gut kannte: Ein siebenzackiges Kreuz – das Zeichen Galottas. Mit einem Mal spürte Kalkarib, wie sein Herz ihm bis an den Hals schlug und er war von einem Moment auf den anderen hellwach. Er sah die Frau an, deren Gesicht er noch immer nicht so recht erkennen konnte, doch er suchte im Dunkeln bei ihr ebenfalls das Zeichen, und tatsächlich, er wurde fündig. Auf dem Stoff über ihrer Schulter erblickte er das zerfranste, aber noch gut erkennbare siebenstrahlige Zeichen des Dämonenkaisers. Er war in einen Raum mit Gefangenen aus Galottas zersprengten Truppen. Er hatte jetzt keine Zeit darüber nachzudenken, denn die Frau neben ihm wurde langsam ungeduldig. „Ja, ja Dschafar“, brachte er mühevoll hervor, wobei er erneut eines der 99. Gesetze brach. Die Frau seufzte zufrieden. „Dann hattest du mehr Glück, als die anderen von Dschafars Leuten“, begann sie zu erzählen. „Das letzte was ich von ihm gesehen hatte war, dass er von darpatischen Truppen eingekesselt wurde. Ihr habt bis auf den letzten Mann gegen sie gekämpft. Wie konntest du entkommen? Wie ich sehe bist du verletzt worden.“ Die Frau, die sich mal als Belzora vorgestellt hatte, deutete auf seine Verletzung am Bein, die er sich beim Kampf gegen die Söldner nahe Perz zugezogen hatte. Wie ein Blitz durchschoss ihm der Gedanke an Adellinde und Sieghelm. Er fragte sich, ob es ihnen gut gehe und ob sie ebenfalls gefangen genommen wurden. Doch dann fiel ihm wieder ein, dass Sieghelm niemals in einen Kerker mit Feindes des Reiches gesteckt werden würde, immerhin war er ein Mittelreicher von Rang und Namen. Er fragte sich auch, warum man IHN mit Galottas Truppen zusammen eingesperrt hatte, doch als er an sich herabblickte, seine Schnabelschuhe und seinen Kaftan sah, wurde es ihm klar: Er war hier im Mittelreich ein Ausländer, ein Niemand ohne Rang und Namen. Er erinnerte sich daran, dass Sieghelm davon berichtete hatte, das novadische Söldner auf der Gegenseite mitgekämpft hatten – wahrscheinlich hielten seine Peiniger ihn für einen von ihnen. Doch wer hatte ihn überhaupt gefangen genommen? Er musste es herausfinden und ihnen schleunigst mitteilen, dass er nicht zu denen gehörte. Doch wie sollte er das anstelle, ohne sich dabei selbst zu entlarven? Die Frau stupste ihn an, anscheinend war er schon länger in Gedanken versunken. „Hey Kleiner, ich hab dich was gefragt.“ Kalkarib brauchte schleunigst eine gute und schlüssige Erklärung, er musste seine Maske vorerst aufrechterhalten, um hier wieder lebendig herauszukommen. Da kam ihm ein Gedankenblitz: „Ich weiß es nicht“, begann er mit schmerzverzerrter Stimme und packte sich an den Kopf. „Mein Kopf, ich … muss wohl ganz schön was abbekommen haben.“ Er strich sich dabei über die verkrustete Stelle an der Schlefe, während er so tat, als hätte er das Gedächtnis verloren. Belzora schien sich damit zufrieden zu geben. „Das hast du wirklich. Armer Kleiner … wie heißt du?“ „Ich …“ begann er mit absterbender Stimme. Kalkarib überlegte kurz, ob er sich schnell einen anderen Namen ausdenken sollte, doch eigentlich hatte es keinen Sinn. Sein Name sollte unter diesen Truppen gänzlich unbekannt sein und eine Lüge weniger würde As’sali gefallen. „ … ich heiße Kalkarib.“ Die Frau holte die inzwischen zurückgelegte Holzschale aus der Mitte und holte noch etwas Wasser aus dem Eimer. Ein Mitinsasse stand protestierend auf, doch als Belzora sich ihm nur ihre Muskeln anspannend wortlos entgegen stellte, ließ er sich wieder auf den Hosenboden fallen und sie trat dabei für einen kurzen Moment ins hereinfallende Licht, so dass Kalkarib ihr Gesicht erkennen konnte. Sie hatte markante Züge, ein breites Kinn, einen Höcker auf der Nase der wohl von einem alten Nasenbruch herrührte – ihr Gesicht aber nicht verunstaltete – hohe Wangenknochen, volle Lippen und hellblaue Augen. Kalkarib fiel aufgrund ihres Gebarens auf, dass sie in der Zelle wohl sprichwörtlich die Hosen an hatte. Sie reichte ihm die Holzschale mit Wasser, die Kalkarib zwar widerwillig, aber gespielt freudig annahm. „Ich weiß, deine Leute mögen nicht von Geschirr Fremder speisen … aber sie haben uns alles abgenommen, wir haben nur diese eine“, sagte sie und setzte sich wieder neben ihm. Zur Überraschung des Wüstensohns schein sie seinen Glauben etwas zu kennen und zu respektieren. „Ich frag unsere Knechter mal, ob sie für dich eine extra Schale haben.“ Als Belzora dies sagte, verschluckte sich Kalkarib am Wasser. Er war in allem Maße überrascht, denn seine Gefühle spielten ihm einen Streich. Sie war der Feind! Ja gut, der Feind eines fremden Reichs, aber sie setzte sich für ihn ein?! Was hatte sie vor? Oder war sie doch einfach nur freundlich. Mit nicht mehr ganz so viel Angst um sein Leben, trank Kalkarib die zweite Schale Wasser aus, um die ihm zwar alle im Raum neideten, das konnte er spüren. Doch keiner hatte genug Mumm in den Knochen, um gegen sie etwas zu unternehmen. Er zählte dreizehn Personen in der kleinen Zelle, während er sich neben der massiven Frau mit den gewaltigen Muskeln ziemlich klein vorkam, aber das Gefühl hatte, vorerst in Sicherheit zu sein.
Teil IV – Nebel des Krieges (3)


Sieghelm Gilborn
von Spichbrecher

Adellinde
Peraine-Geweihte
Der Ordensmeister kehrte nach erfolgloser Suche zum provisorischen Lager zurück. Adellinde saß dort noch immer zusammen mit Hagen aus Waldsend und sie schienen in ein intensives Gespräch vertieft, weshalb er sie nicht stören wollte. Er ging zu seinem Pferd und nahm einen kräftigen Schank aus seinem Wasserschlauch, denn von dem Leichengestank war seine Kehle ganz trocken geworden. Er überprüfte seine Ausrüstung, ging die Vorräte durch und friemelte hier und dort an seiner Plattenrüstung herum. Der Marsch über das Mythraelsfeld hatte den Glanz von deinem Rüstzeug genommen und er musste sich daran machen, sie wieder auf Vordermann zu bringen. Also packte er sein Putzzeug aus, hockte sich scheppernd auf einen umgefallenen Baumstamm und begann seine Rüstung zu reinigen. Kaum hatte sich der Reichsritter hingesetzt, hüpfte Pagol heran, umschwänzelte dessen Beine und ließ sich dann erschöpft zu seinen eisenbewehrten Füßen nieder. Die Zeit verging quälend langsam. Adellinde unterhielt sich währenddessen immer intensiver mit dem Leichenfledderer. Sieghelm bekam nur ein paar Wortfetzen mit, anscheinend hielt sie ihm keine Predigt, sondern versuchte den Mann dazu zu bewegen, sein Handeln zu hinterfragen. Dieser wiederum hing an ihren Lippen und lauschte sehr aufmerksam ihren Worten. So verstrich die Zeit und während Sieghelm seine Rüstung putzte, fragte er sich immer wieder, ob Kalkarib wohl etwas gefunden haben könnte, dass er jetzt schon so lange wegblieb. Das Gespräch zwischen Hagen und Adellinde unterbrach sie irgendwann mit den Worten: „Ihr müsst darüber nachdenken, ich lasse euch für einen Moment in Ruhe.“ Die zierliche Priesterin ging zum Ritter herüber und setzte sich vorsichtig neben ihn. Sie stöhnte etwas, was Sieghelm dazu veranlasste nachzufragen: „Stimmt etwas nicht?“ Sie schien etwas aus den Gedanken gerissen und zögerte mit der Antwort. „Nein, es ist alles in Ordnung. Ich musste nur gerade daran denken, dass ich so etwas schon lange nicht mehr getan hatte.“ „Was meint ihr?“ „Diese Art von Unterhaltung. Einer in seinem Glauben wankenden Person durch meine Worte wieder Halt zu geben. Das war eigentlich eine meiner Hauptbeschäftigungen in Perz. Bevor all dies geschah“, schob sie noch hinterher und rührte dabei genervt wirkend mit dem Finger in der Luft. Sieghelm hob seine Augenbrauen und dachte kurz nach, während er seine Unterarmschienen polierte. „Gab es in eurem Ort denn so viele vom rechten Weg Abgekommene?“ Adellindes Augen wurden kugelrund als der Reichsritter fragte. „Oh ihr würdet staunen, wie viele Leute Gareth verlassen hatten, um ihr Glück anderswo zu suchen. Wehrheim ist … war … eine verheißungsvolle Garnisonsstadt, in der man sein Leben stets in den Dienst des Kaisserreichs stellen konnte. Es gab viele rastlose Seelen, die noch nie Gareth verlassen hatten, um in Wehrheim ein neues Leben anzufangen. Doch Aves sei dank, haben sie unterwegs ihr Leben hinterfragt und haben so manches mal bei uns im Tempel halt gemacht, um nach Rat zu suchen.“ Sieghelm unterbrach sie: „Moment, das heißt ihr habt es Ihnen ausgeredet?“ Adellinde war schockiert und legte eine Hand auf ihre Brust. „Es Ihnen ausgeredet? Nein! Peraine ist meine Zeugin, das habe ich nicht. Ganz im Gegenteil!“ Sieghelm atmete erleichtert aus. „Dann ist gut. Ich hatte schon befürchtet ihr …“ „Ich habe Ihnen nur wieder Vertrauen in die Zwölfe und damit erneut Halt im Leben gegeben.“, unterbrach sie den Reichsritter und pulte sich dabei in den Fingernägeln herum. Sieghelm, der das Putzen einstellte, belegte die Priesterin nun mit einem scharfen Blick und holte für einem längeren Satz tief Atem, als direkt hinter ihnen die Pferde plötzlich scheuten. Der wachsame Ritter sprang sofort auf und griff zum Schwert, welches er wegen der Rüstungspflege mit samt der Scheide abgelegt hatte. Auch Pagol sprang auf und sah sich wachsam um. Nur Adellinde blieb blinzelnd und leicht verwirrt sitzen. „Ist bei euch …“ „Pssst!“, zischte Sieghelm sie an, während seine braunen Augen das lichte Waldgebiet absuchten. „Beruhigt die Pferde und macht sie los“, begann er im leisen Tonfall zu erklären. „Kalkarib ist schon lange fort und nur die Götter wissen, was hier noch so durch das Unterholz streicht.“ Mit seinem Anderthalbhänder noch in der Scheide, schritt Sieghelm das provisorische Lager ab und schaute in alle Richtungen, während die Geweihte, wie ihr befohlen, zu den drei Pferden ging und sie versuchte zu beruhigen.
Das Waldstück, in dem sich Sieghelm und seine Gefährten befanden, gehörte zum leicht hügeligen Gebiet des Flusses Gernat. Der flößbare Seitenarm der Dergel befand sich rahjawärts von ihnen, weshalb es in diese Richtung leicht bergab ging. Und aus eben dieser Richtung kommend, sah Sieghelm in der Entfernung Bewegungen durch die Bäume hindurch. „Dort kommt etwas auf uns zu. Macht die Pferde bereit, Adellinde“, raunte Sieghelm ihr erneut zu. Zügig legte er kurz das Schwert ab, schnappte sich seinen Helm und streifte ihn sich über den Kopf. Inzwischen war auch der in seinen Gedanken versunkene Leichenfledderer wieder ‚erwacht‘ und da er den Ritter alarmiert umschauen sah, erhob er sich, war sich jedoch unsicher, was er tun sollte und stand daher nur wie angewurzelt da. Die Geweihte löste die Zügel der Pferde, half Pagol auf seinen Hochsitz und verstaute so schnell und gleichwohl lautlos, wie sie konnte, die Ausrüstung. „Was ist mit Kalkarib?“, rief sie im lauten Flüsterton zu Sieghelm herüber, der Mühe hatte, die Bewegungen im Dickicht auszumachen. „Er wird unserer Fährte folgen müssen“, antwortete er und kniff die Augen zusammen. Da heulte plötzlich in einem ohrenbetäubenden Lärm eines der Pferde auf, stieg in die Lüfte, dass Adellinde, die gerade die Zügel in der Hand hatte, mitgerissen wurde, und fiel dann mit einem lautem rumsen seitlich zu Boden. Die Priesterin hatte Glück und landete wieder auf ihren Beinen und kam nur etwas ins Straucheln. Doch das Pferd hatte zwei Pfeile in der Flanke stecken. Anhand der Position der Pfeile erkannte Sieghelm sofort, dass sie aus einer anderen Richtung als das Flussbett kamen und sie sich daher in unmittelbarer Gefahr befanden. „Hinterhalt!“, rief er und ließ Custoris unter einem kaum hörbaren Donnergrollen aus der Schwertscheide schnellen. Die beiden anderen Pferde wurden plötzlich so aufgeregt, dass es mit ihnen durchging und sie aus dem Stand lostrabten. Adellinde konnte ihre Hand noch in letzter Sekunde aus der Schlaufe des Pferdes holen und wurde somit nicht mitgerissen. „Lauft schnell, in diese Richtung!“, befahl der Ritter im lauten Ton und deutete mit der langen Schwertscheide, die er in seiner Linken hielt, in Richtung Efferd. Adellinde brauchte einen Moment, um sich von dem Schreck zu erholen, doch dann eilte sie los. Auch Hagen nahm die Beine in die Hand und begleitete sie, während sich im Rennen seine Arme und Beine zu überschlagen begannen. Sieghelm, der in einer über fünfzig Stein schweren Metallrüstung stand, wusste, dass es keinen Sinn hatte zu rennen und es nicht nur rondragefällig, sondern auch noch nandusgefällig war, sich langsam fortzubewegen und sich dem Feind zu stellen, anstatt vor ihm zu fliehen. Er hatte die zwei in Richtung Burg Auraleth geschickt, in der Hoffnung, dass dort noch Praioten waren, die Ihnen Schutz bieten konnten oder sie sich zumindest in den zahlreichen geschliffenen Wehrmauern verstecken und Schutz suchen konnten.
Der Ordensmeister musste nicht lange warten, er folgte zwar in zügigen Schritten den anderen, doch rasch kamen aus dem Dickicht mehrere Gestalten hervor. Die Götter hielten für ihn eine weitere Prüfung bereit. Er hatte auf seiner Queste schon gegen Ghule und abtrünnige Söldner kämpfen müssen, doch in Galottas Heerwurm kämpfen noch andere widerwärtige Kreaturen mit. Da der Fäulnis- und Verwesungsgeruch wegen der zahlreichen gefallenen Streiter und der zerstörten Untoten auf dem Mythraelsfeld allgegenwärtig war, war es unmöglich diese Gruppe im Vorhinein auszumachen. Aus dem Dickicht kamen mehrere Skelette mit Bögen und schartigen Äxten und zum Teil verweste Untote in verrosteten Rüstungsteilen und schartigen Schwertern. Er zählte sechs von Ihnen, die den Hinterhalt gelegt hatten, während sich eine wohl noch größere Anzahl flusswärts befand.
„In Namen der leuenköpfigen Göttin, Herrin Rondra, ich stehe hier – dein Streiter – und ersuche dich erneut um deinen Beistand“, begann er in absichtlich lauten Ton, um die Untoten auf sich zu lenken, während Adellinde das Weite suchte. Sieghelm musste hilflos mitansehen, wie die zwei skelettierten Bogenschützen Pfeile aus ihren Köchern holten und auf die Sehnen ihrer knarzigen Bögen legten, denn er war noch zu weit von ihnen entfernt und außerdem waren da noch die vier Nahkämpfer, die einen Ansturm unmöglich machten. Leider hatte er kein Schild, denn das war mit dem Pferd durchgegangen. Er hatte nur sich, Custoris und seinen Glauben an Rondra – was Sieghelm genügte. Der erste Pfeil schoss zischend an Sieghelm vorbei, Rondra sei dank waren Untote miserable Bogenschützen. Der zweite flog direkt auf ihn zu, doch mit einem beherzten Hüpfer zur Seite brachte er sich aus der Schussbahn. „Herrin sieh her, ich werde nicht wanken, während ich Thargunitoths Gezücht zerschlage. Denn du bist bei mir.“ Sieghelm nutzte das Überraschungsmoment, auch wenn die Untoten wohl nicht in der Lage waren, sich überraschen zu lassen, aber zumindest hatte er dann den Vorteil, schneller bei den Bogenschützen sein zu können. Er rannte schlagartig auf sie zu und wurde unterwegs von einem Untoten in rostiger und zerfledderter Kettenrüstung und einer Handaxt abgefangen. Schon in der Bewegung schwang Sieghelm Cursoris und ein Donner ertönte, als der mächtige Schwung glatt den morschen Holzstil der Axt samt Oberkörper des Untoten Dieners mühelos durchschlug. Eine Untote Bäuerin mit einem nagelbewährten Kantholz schlug halbherzig von der Seite zu, als Sieghelm an ihr vorbeistürmte, wobei die rostigen Nägel wirkungslos über Sieghelms Plattenrüstung kratzten. Der Ritter war nicht aufzuhalten und noch ehe einer der Bogenschützen den zweiten Pfeil auf die Sehne gelegt hatte, schlug Sieghelm erneut zu. Mühelos und fast ohne Widerstand durchschlug das Schwert die magisch erhobenen Knochen, die bei ihrem Weg zum Boden in ihre Einzelteile zerfielen. Mit einem rostigen Breitschwert und einem verblichenen Wappenschild bewaffnet trat ihm ein untoter Soldat entgegen. Im von Fäulnis durchzogenen Gesicht des ehemaligen Gardisten aus Warunk, was Sieghelm an den Fetzen seines Wappenrocks erkannte, tummelten sich zahlreiche Maden – was Sieghelm für einen kurzen Moment erschaudern ließ, als er in die augenlosen Löcher im madenzerfressenen Schädel des Gardisten blickte. Sieghelm holte aus und hatte die Gunst des ersten Schlags, da sein Bihänder mehr Reichweite hatte als das rostige Schwert des Untoten. Mit einem feuchten Kratzen wehrte der Untote Gardist den Schlag mit dem Wappenschild ab, wobei ein Stück davon abplatzte. Aus dem Augenwinkel sah Sieghelm wieder die untote Bäuerin in Schlagdistanz kommen, weshalb er zu einem riskanten Manöver ansetzte. Mit der Linken, in der sich noch immer die Schwertscheide befand, stach er beherzt nach der Bäuerin, während er mit der Rechten einen schwungvollen Hieb nach dem Gardisten schwang. Die metallene Spitze der Schwertscheide bohrte sich mühelos in den weichen Schädel der Frau und blieb darin stecken, während Sieghelms Schwerthieb von dem Gardisten erneut mit dem morschen Schild abgewehrt wurde. Da bekam der Reichsritter einen kräftigen Stoß gegen den Rücken, das Metall heulte auf und gab nach. Er spürte einen ihn aus dem Gleichgewicht bringenden Faustschlag gegen sein Schulterblatt. Ein Pfeil hatte aus nächster Nähe seine Plattenrüstung durchschlagen und war in den darunter liegenden Kettenteilen hängen geblieben. Die im Pfeil enthaltene Kraft entlud sich dann als heftiger Faustschlag in das Schulterblatt des Streiters. Sieghelm kam leicht ins Wanken, konnte aber nun endlich sein Schwert mit zwei Händen packen um seinen ganzen Vorteil auszuspielen. Dennoch musste er aus einer unvorteilhaften Position zwei gute Schläge des Gardisten abwehren, was ihm nur mühevoll gelang. Mit flinken Füßen umtänzelte er anschließend den Warunker, um ihn zwischen sich und dem Bogenschützen zu bringen. Der letzte Nahkämpfer stellte sich neben den Gardisten, auch diesen musterte Sieghelm kurz, um seine Kampffähigkeit einschätzen zu können. Es war zu seiner Verwunderung ein nur leicht verwester Leichnam eines Tulamiden. Die leichten und bunten, jedoch etwas verblichenen und matschbedeckten Stoffe, der Turban und das krumme Schwert, welches er in seinen Händen hielt, waren eindeutige Hinweise. Plötzlich musste, auch wenn er kein Tulamide war, Sieghelm an Kalkarib denken und daran, was ihm wohl zugestoßen war oder ob er sich in Sicherheit bringen konnte. Er hoffte, dass es dem Sohn der Wüste gut ging, doch im Moment hatte Sieghelm ganz andere Sorgen. Der Warunker Gardist und der untote Tulamide begannen ein Feuerwerk aus kurzen Schlägen auf Sieghelm regnen zu lassen, den meisten davon wich Sieghelm aus, indem er kontrolliert zurückging. Währenddessen lauerte auf eine gute Gelegenheit. Als der Tulamide mit seinem Säbel einmal zu weit ausgeholt hatte, zuckte Sieghelm aus der Oberhau Position einmal mit dem Anderthalbhänder kurz herab, binnen eines Lidschlags durchschlug die Spitze des Schwerts den zerfledderten Turban und spaltete den Kopf des Untoten. Blut und Hirn spritzte in alle Richtungen und der Leichnam brach zusammen, so dass nur noch der untote Gardist und der eine Bogenschütze standen. Ein Pfeil zuckt plötzlich über die Schulter des Gardisten und streifte Sieghelm am Helm. Er musste sich beeilen, irgendwann würde ein Pfeil ihn treffen. Erneut hob der Ordensmeister das Schwert in den Oberhau und deutete einen Schlag von oben an, der Gardist tat es ihm gleich und brachte sein inzwischen löchriges Schild ebenfalls nach oben. Darauf hatte Sieghelm gewartet, er schlug zu und zwang den Gardisten zur oberen Abwehr, doch der Schwerthieb war nur eine Ablenkung, die wirkliche Gefahr drohte von Sieghelms Fuß, den er mit aller Kraft voran in den Bauch des Untoten trieb. Hätte der Untote noch einem Atem gehabt, hätte er ihn jetzt wohl verlassen, denn der Gardist flog mit Wucht nach hinten und landete auf dem Rücken und verlor dabei sein rostiges Schwert. Sieghelm setzte nach und stach mit der Spitze über ihn stehend in den Brustkorb. Es knirschte und blubberte feucht, als der weiche Oberkörper nachgab, denn das Kettenhemd blieb stabil und wurde ins Innere des vermoderten Körpers gedrückt. Dann setzte er zu einem Sprint an und schoss auf dem Bogenschützen zu. Der Hieb, der das Skelett in seine Einzelteile zerlegte, war dann nur noch Formsache.
Schwer atmend überblickte Sieghelm das Kampffeld, er hatte den Hinterhalt besiegt, doch eine große Schar weiterer Leichname, Untoter und Skelette war im Anmarsch. Einige Pfeile schlugen rund um ihn ein oder purzelten wirkungslos, weil von den Ästen der Bäume abgelenkt, von oben heran. Sofort zog er schmatzend die Schwertscheide aus dem Kopf der ehemaligen Bäuerin und nahm die Beine in die Hand. Er hatte noch immer einen Pfeil im Rücken stecken, was ihm beim Rennen behinderte. Doch zum Glück knickten unterwegs die sich überlappenden Metallteile am Rücken den Pfeil ab, doch der Druck im Rücken blieb. Er hatte jedoch keine Zeit, sich jetzt darum zu kümmern. Er versuchte Adellinde und den Leichenfledderer zu erspähen, doch die Beiden waren schon außer Sicht. Da dachte Sieghelm an den Leutnant: Wo war er? War er mit den beiden mitgerannt, um sie zu beschützten? Das letzte Mal, als er ihn gesehen hatte, lag er zu seinen Füßen und bei dem Kampf eben war er nicht dabei. Er hoffte das es ihm und allen anderen gut ging, denn er war nun alleine, auf sich gestellt und noch längst nicht in Sicherheit. Er rannte so schnell es in der Plattenrüstung möglich war – denn der Gegner war ihm zahlenmäßig zu sehr überlegen. Zudem würde er nicht die Ausdauer haben, ewig zu rennen – denn die Untoten – wenn sie auch langsam waren, würden niemals erschöpfen.
Sieghelm hörte sich im Innern des Helms unterwegs schwer atmen, seine Brust brannte, doch er wusste, er musste Distanz zwischen sich und die Untotenschar bringen. Leider verlor er unterwegs seinen einzigen Orientierungspunkt aus den Augen, die Zinnen von Burg Auraleth, weshalb er nicht wusste, in welche Richtung er rannte. Er musste schnell etwas finden, wo er einen taktischen Vorteil bekam und sich etwas verschnaufen konnte. Doch die nur leicht hügelige Ebene war viel zu flach für eine Engstelle, Höhlen konnte er auch nicht ausmachen und der Wald zu licht, um sich im Unterholz zu verstecken.
Währenddessen eilten auch Adellinde und Hagen stolpernd durch den Wald. Sie folgten den weit entfernten Festungsmauern von Burg Auraleth, in dessen Richtung sie Sieghelm geschickt hatte. „Komm schon, lauft weiter! Glaubt an euch!“, rief sie ihm außer Atem zu. Doch der Fledderer schien nicht bei bester Gesundheit und Kondition zu sein und hustete unterwegs ungesund. Zumal er immer wieder anhalten musste, um durchzuatmen. Währenddessen schaute sich Adellinde hektisch nach dem Reichsritter um, sie wollte ihn nicht verlieren, war er ihr in den kurzen Zeit doch irgendwie ans Herz gewachsen. Durch den lichten Wald hindurch hörte sie jedoch nur das Geschepper der Untoten, die durch das Unterholz marodierten. „Wir müssen weiter!“, trieb sie Hagen an. „Ich kann nicht mehr“, hustete er und stützte sich auf seinen Knien ab. „Wenn wir bleiben, sterben wir!“, schrie sie ihn an und sah, dass bestimmt ein dutzend Untoter gerade über die Spitze eines Hügels auf sie zu eilten. „Das … ist mir gleich“, antwortete er und spuckte aus. „Was redet ihr da! Los, kommt weiter!“ Adellinde versuchte dem Mann, ihrem Ekel vor seinem Körpergeruch zum Trotz, unter den Arm zu greifen und weiter zu ziehen, doch er entzog sich ihrem Griff. „Lasst mich! Ich … werde hier bleiben … und sie aufhalten.“ „Bei der gütigen Göttin, redet nicht so einen Unsinn daher! Ihr würdet sterben! Ihr habt ja nichtmal eine …“ Adellinde hatte den Satz nicht mal zuende gesprochen, da zog der Fledderer einen Langdolch aus seinen Schaftstiefel. Für einen ganz kurzen Moment rutschte Adellinde das Herz in die Hose, wollte er sie jetzt und hier abstechen? Doch als sich Hagen umdrehte, wurde ihr bewusst, dass der lebenstolle Mann aus Waldsend vor hatte, sich mit dem Dolch den Untoten entgegen zu stellen. „Ich verschaffe euch etwas Zeit … nun lauft schon.“ Adellinde zögerte. Sie kannte den Mann nicht. Sie hatte mit ihm nur geredet und nun wollte er sich für sie opfern?! Sie wusste nicht was sie sagen sollte. Ihre Lippen zitterten und ihr wurde ganz kalt bei dem Gedanken daran. „Ich danke euch, Euer Gnaden … und nun lauft endlich!“ Für mehr war keine Zeit, ein letzter Blick und Adellinde eilte wieder los. Ihr liefen die Tränen, als sie unterwegs hörte, wie Hagen die Untoten beschimpfte, um etwas Zeit für Sie zu gewinnen. Sie blickte nicht zurück, sie wusste, dass er dort gerade starb – sein Leben gab – für sie. Mit Tränen in den Augen rannte sie so lange sie konnte.
Teil IV – Nebel des Krieges (2)


Sieghelm Gilborn
von Spichbrecher
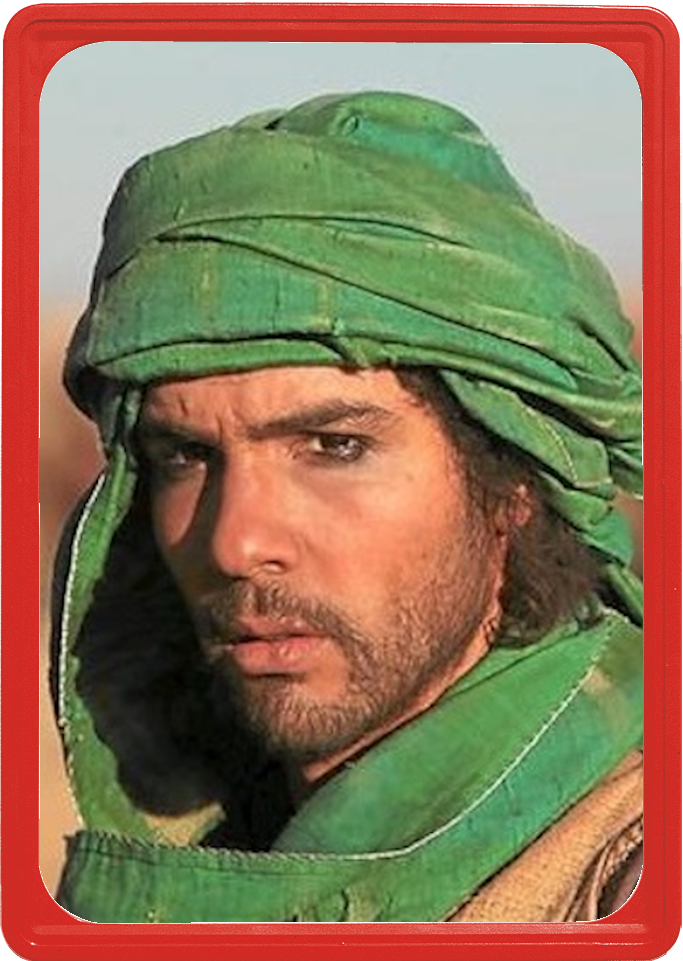
Kalkarib
al’hashinnah

Adellinde
Peraine-Geweihte
„Hier, hier hab ich es gefunden.“ Die unangenehme Stimme des Leichenfledderers
überschlug sich, als er mit seinen dreckigen Händen auf eine Stelle am Boden
zeigte. Sie hatten mehr als eine Stunde gebraucht, um diesen Ort zu erreichen,
der genau wie jede andere Stelle auf dem Schlachtfeld aussah. Der von
Leichengeruch geschwängerte Nebel lag noch immer schwer auf dem Mythraelsfeld
und hielt dieses fest in seinem Griff. Sie mussten über Berge aus Leichen
steigen, um diesen, etwas im Firun gelegenen, Schlachtfeldabschnitt zu finden.
Die zum Teil schon verfaulten Körper der zahllosen und zusammengewürfelten
mittelländischen Truppen, die nun den aufgewühlten und nassen Boden des Feldes
bedeckten, waren aufgebläht, zerrissen oder von Tieren und Ghulen bis zur
Unkenntlichkeit zerfleddert worden. Da Sieghelm der einzige der Dreien war, der
diesen Anblick kannte, fiel es Kalkarib und Adellinde schwerer als ihm, all
diese Eindrücke zu verarbeiten und auszuhalten. Die Hüterin der Saat musste
sich unterwegs zwei Mal übergeben. Kalkarib und Sieghelm räumten ihr die Zeit
ein, sich danach wieder zu ordnen, doch es war ihr sichtbar unangenehm.
„Schaut her, da ist sie!“, krakelte der Mann erneut. Sieghelm
stieg über eine breite Bodenfurche zu ihm herüber. Auf dem Boden, eingedrückt
und von Schlamm bedeckt, lag eine Frau, die Sieghelm auf Anhieb erkannte, da er
ihr Gesicht, obwohl es blutleer und zerkratzt war, in guter Erinnerung hatte. „Oh bei der Leuin“, hauchte er traurig. „I-Ich hab es dort von der Rüstung …“
„Schweig still!“, fuhr Sieghelm scharf mit bitterbösem Blick zwischen die
Erklärung des Fledderers. „Geh herüber
zur Geweihten, wir entscheiden später über dein Schicksal.“ Der bärtige
Mann nickte so heftig, dass es aus seinem dreckigen und dichten Bart nur so
rieselte. Sofort nahm er die Beine in die Hand und eilte zu Kalkarib und
Adellinde herüber. Sieghelm kniete sich zu der Frau nieder, der Geruch von Tod
stieg ihm deutlicher denn je in die Nase. Die Frau die dort lag war Lady
Raulgard aus dem Hause Ochsenhaupt. Sie war eine landlose Ritterin am Hofe
seines Vaters Parzalon und seines Großvaters Torion II. in Dettenhofen.
Sieghelm erinnert sich noch gut an sie. Zwischen 17 und 21 Hal, bevor er in den
Pagendienst bei Ritters Trautmann ging, lebte er noch am Dettenhofener
Stammsitz. Lady Raulgard stand schon seinem Großvater beratend zur Seite und
nach dessen Ableben 24 Hal dann seinem Vater. Sieghelm hatte sie als Kind immer
bewundert. Anfangs für ihr beeindruckendes Schwert, einem Anderthalbhänder, das
er sogar einmal halten durfte. Doch damals war er noch zu schwach, um es heben
zu können. Ihre Worte klingen noch bis heute nach und er hörte sie nun erneut,
als stünde sie wieder vor ihm: „Jeder Bauer kann ein Schwert halten, aber nur
ein wahrer Krieger wird es zu führen wissen.“ Sieghelm musste häufig an diesen
Satz denken. Während seiner Zeit bei Ritter Trautmann, aber auch während seiner
Zeit an der Akademie der Feuerlilien in Rommilys. Er hatte Lady Raulgard ihr
Schwert nie zum Kampf ziehen sehen, aber in seiner kindlichen Vorstellung,
konnte sie anmutig und doch kraftvoll damit umgehen. „Was sagtet ihr?“, frug Adellinde, die plötzlich in einem
respektvollen Abstand hinter dem Reichsritter stand. Sieghelm, der zuerst nicht
wusste, dass er die Worte laut ausgesprochen hatte, blickte aus der Hocke zu Adellinde
nach hinten und sie schloss dann zu ihm auf. Er begann dann zu erklären: „Ich kenne diese Frau, es ist Lady Raulgard
vom Hofe meines Vaters. Sie muss in der Schlacht ganz dicht bei ihm gewesen
sein, als sie fiel. Und ich …“, er machte eine kurze Atempause, „… musste nur an einen Leitspruch denken,
den sie mir als Kind einst mitgab: ‚Jeder Bauer kann ein Schwert halten, aber
nur ein wahrer Krieger wird es zu führen wissen.‘“ „Ein weiser Leitsatz“, entgegnete
sie. „Mit eurer Erlaubnis, würde ich
gerne einen Segen für eure Bekannte sprechen.“ Adellindes Stimme war zart
und ihre großen blauen Augen tränten noch immer. Es fiel ihr sichtlich schwer,
sich auf dem Schlachtfeld aufzuhalten und es gelang ihr gerade so, die Fassung
zu bewahren. „Ja, bitte tut dies – sie
hätte bestimmt Nichts dagegen.“ So stellte sich Adellinde an das Kopfende
der Ritterin, konzentrierte sich kurz und sprach dann einen Peraine-Segen über
der geschundenen Körper. Währenddessen suchte Sieghelm das umliegende Feld ab.
Auch er rang für einen Moment mit den Tränen und wollte sich das nicht anmerken
lassen. Wenn Lady Raulgard hier lag, würde das bedeuten, dass die Truppen
seines Vaters hier gewesen sein müssen. Sie war stets an dessen Seite
geblieben, da sie sich selbst wie eine Art Leibwächter gesehen hatte. Sie
hatten also eine erste Spur aufgenommen, doch auf dem nebeligen Schlachtfeld
schien es sehr schwierig, weitere Hinweise zu finden.
Eine lange
Zeit suchten alle drei den Bereich um die tote Frau ab. Sieghelm hatte ihnen
zuvor gesagt nach welchen Farben sie Ausschau halten sollten. Sie fanden zwei
weitere tote Infanteristen in den Dettenhofener Farben, doch keinen Hinweis auf
seinen Vater. Das Schlachtfeld war zu aufgewühlt, um anhand von Spuren deuten
zu können, wohin sich sein Vater mit seinen Truppen bewegt haben könnte. Als sie begannen sich immer weiter voneinander
zu entfernen, dass sie drohten sich im Nebel zu verlieren, wurde es Kalkarib
irgendwann zu viel. „Das hat doch keinen
Sinn!“, fluchte er im novadischen Akzent. Da er gerade irgendwo alleine im
Nebel über einem Haufen Leichen stand, konnten die anderen nur seinen Fluch
hören, ihn aber nicht sehen. Auch Leutnant Pagol suchte unermüdlich mit, doch
zu viele fremde Gerüche lagen auf dem Feld, so dass auch seine Nase keine
Fährte aufnehmen konnte. Mit resignierenden Blick stieß der Wüstensohn auf
Sieghelm. „Alles spricht dafür, dass euer
Vater – wenn er noch lebt – hier nicht gefallen ist. Doch wissen wir nicht in
welche Richtung er weiter gezogen ist.“ „Er lebt noch, das spüre ich“, antwortete
Sieghelm im barschen Ton und setzte fort: „Doch
was wir brauchen, ist ein Zeichen, eine Spur, ein Wunder … irgendwas.“ Keinen
Moment später sahen Kalkarib und Sieghelm den Rücken eines schmalen, ja fast
schon dürren Mannes in langer feiner Robe und Turban auf dem Kopf, der gerade
an ihnen vorbeirannte. Er eilte leichtfüßig über die Leichenberge hinweg, als
wären sie nicht da und gerade als er drohte im Nebel zu verschwinden, sahen die
beiden wie der dürren Gestalt etwas Grünes aus einer Umhängetasche purzelte und
zu Boden fiel. Sieghelm und Kalkarib blickten sich einander verdattert an.
Sieghelm rieb sich die Augen, als würde er phantasieren und Kalkarib vollführte
eine bittende Geste zu Rastullah. „Hast
du das auch gerade gesehen?“, frug Sieghelm. „Ja, und ich kann es kaum glauben.“ „Ich auch.“ Und danach sagten
beide gleichzeitig: „Ich wusste gar nicht
das Nehazet rennen kann!“ Es war tatsächlich Magister Nehazet, den sie
beide gesehen hatten, oder zumindest bildeten sie sich das beide ein. Sie
eilten sofort zu der Stelle, wo der angebliche Nehazet etwas verloren hatte und
fanden dort, frisch fallen gelassen, ein am Boden liegendes handgroßes Blutblatt
mit einem Zeichen darauf. Gerade als Kalkarib es hochheben wollte, unterbrach
ihn Sieghelm: „Halt! Schau doch … ist das
… ein Pfeil?“ Das auf dem am Boden liegenden Blutblatt, hatte eine rote
Stelle in der Mitte, dass so aussah wie ein
Pfeil. Sofort blickte Kalkarib durch den Nebel zur Praiosscheibe, um das
Blutblatt und den Sonnenstand in Zusammenhang zu bringen „Er zeigt Richtung … wie ihr sagt … Firun.“ Euphorisch blickten
sich die beiden jungen Männer einander an. „Ich
weiß nicht, wie er es angestellt hat, aber wir müssen dem Magister wohl danken,
wenn wir ihn wieder sehen“, sprach der Reichsritter und lächelte dabei
breit. Mit einem anspornenden Klopfen auf des Wüstensohns Schulter fügte er
noch an: „Komm mein Freund, wir haben
unser Zeichen erhalten und kennen nun die Richtung.“
Mit
Aufbruchsstimmung im Gesicht und Schwung im Körper stießen die beiden Männer
wieder zu Adellinde, die die Pferde bei sich behielt und zusammen mit Pagol
über den am Boden sitzenden und gefesselten Fledderer wachte. „Wir wissen wo es langgeht“, prahlte
Sieghelm stolz, als hätte er selbst diese Erkenntnis gehabt, als er im Nebel vor
Adellinde auftauchte. „Ähm, hervorragend.
Es gibt noch etwas über das wir entscheiden müssen“, antwortete sie. Als
Sieghelm die Zügel seines Pferdes in Empfang nahm, war er in eiliger
Aufbruchsstimmung. „Achja? Das können wir
auch unterwegs …“ Adellinde räusperte sich ungewöhnlich lange und
lautstark, so dass auch Sieghelm es nicht überhören konnte. Er hatte über die
Götterläufe hinweg gelernt, dass, wenn das jemand in seinem Umfeld tat, er
besser seine aktuelle Handlung zügig einstellen und für einen kurzen Moment
zuhören sollte. Sein Blick traf sich mit dem von Adellinde, die eine nickende
Geste zu dem am Boden sitzenden Leichenfledderer machte. „Oh! Ja“, entfleuchte es ihm. Die Priesterin und der Reichsritter
zogen sich dann zurück, um sich auszutauschen. Währenddessen blieb Kalkarib mit
Pagol bei ihrem ‚Gefangenen‘. Der junge Wüstensohn konnte ein anfangs ruhiges
und dann immer hitziger werdendes Gespräch beobachten. Aus der Entfernung sah es
irgendwie bizarr und gleichzeitig komisch aus, da Sieghelm nicht nur zwei Köpfe
größer war als die kleine Geweihte, sondern aufgrund seiner Statur und Rüstung
auch noch zwei Mal so breit wie sie. Er musste an ein Märchen denken, dass
Delia mal ihrem Sohn vorgelesen hatte, dass sie aus der Bibliothek des Magiers
hatte. Eine horasische Geschichte mit dem Namen ‚Die Schöne und das Thier‘.
Obwohl ihr körperlich in allen Belangen überlegen, zeigte Adellinde wie ‚die
Schöne‘ in der Geschichte keine Spur davon, von ‚dem Thier‘ eingeschüchtert zu
sein. Adellinde wich keinen Fingerbreit von ihrer Position, und das obwohl
Sieghelm mit seinen großen und kräftigen Händen, die so groß waren wie Teller,
sie mühelos hätte zerquetschen können. Sieghelm gestikulierte und fuchtelte
herum, doch keine seiner Bewegungen kam ihr näher als eine Handbreit. Trotz
seiner Wuchtigkeit schien es so, als hätte Adellinde eine unsichtbare und
schützende Aura um sich, die ‚das Thier‘ nicht zu durchdringen vermochte.
Adellinde jedoch konnte ohne Mühe in seine Aura eindringen, denn erneut legte
sie während einer Tirade aus wilden Fuchteleien ihre zierlichen Zeigefinger auf
seine Lippen und drückte sie mühelos zusammen. Er erstarrte in diesem Moment,
sie sagte abschließend noch etwas zu ihm und verließ ihn dann, woraufhin ‚das
Thier‘ mit hängenden Schultern hinterhertrottete. Als sie beide wieder bei
Kalkarib ankamen, hatte Sieghelm wieder seine erhabene Haltung angenommen.
Zusammen stellten sie sich dann vor den am Boden sitzenden Fledderer, den
Adellinde im scharfen Ton aufforderte aufzustehen.
„Wir haben entschieden, wie du deine
schändlichen Taten wiedergutmachen kannst“, verkündete die Geweihte einleitend und blickte dann
zu Sieghelm, der einen Moment brauchte, um sich geistig zu sammeln. „Du hast den Zwölfen gefrevelt mit deiner
Tat. Du hast von den Toten genommen, um dich selbst daran zu bereichern, doch
du kannst deine Tat wiedergutmachen.“ Der bärtige Mann starrte abwechselnd
die beiden ungläubig an, er hatte wohl eher mit einer Hinrichtung gerechnet.
Dann fuhr Sieghelm fort: „Im Namen der
Herrin Peraine, haben wir entschieden, dass du auf unserem Weg vom Schlachtfeld
herunter, weiter die Symbole, Ketten, Ringe und Zeichen nimmst – jedoch unter
Aufsicht der Geweihten – damit du es mit Anstand und Respekt tust. Du sollst
die Last der Wertgegenstände spüren und dafür arbeiten sie zu tragen – so will
es die Herrin Peraine. Wenn wir das Schlachtfeld verlassen, wirst du uns alle
Gegenstände übergeben und wir werden sie an die Pferde binden um sie dann im
nächsten Tempel abzugeben. Und du wirst, so du im Schweiße deines Angesichts
ausreichend gearbeitet hast, von uns aus deiner Schuld entlassen und wirst zum
nächsten Tempel gehen, um dort um Vergebung für deine Taten zu bitten.“ Mit
den letzten Worten schaute Sieghelm wieder zur Priesterin. In seinem Augen lag
ein fragenden Blick, der so viel sagte wie: ‚Habe ich etwas vergessen?‘ Doch
Adellinde nickte zufrieden. „Das ist zu
gütig, Herr!“, stotterte der bärtige Mann. Für einen kurzen Moment flammte
in Sieghelm ein ‚JA ist es!‘ auf, doch die Hand von Adellinde, die ihn sanft am
Oberarm berührte, hielt ihn zurück. „Ich danke euch, ich danke euch!“, wimmerte
er glücklich, fiel auf die Knie und
grabschte nach Sieghelms Stiefel, um diese zu küssen. „Dankt Peraine und bittet sie um Vergebung für eure Taten.“, intervenierte
Adellinde und half ihm wieder auf die Beine. Mit Tränen in den Augen versprach
er es ihr, während Sieghelm angewidert daran denken musste, wie sie mit ihren
reinen und unschuldigen Händen nur diesen räudigen Taugenichts anfassen konnte.
Kurze Zeit
später waren sie auf dem von Magister Nehazet gezeigten Weg. Adellinde
überwachte, wie der Fledderer, der sich als Hagen aus Waldsend vorstellte, einen
immer schwerer werdenden Sack voller Wertgegenstände füllte. Doch tat er dies
augenscheinlich mit Freude und Glückseeligkeit. Sieghelm hinterfragte sich
selbst, denn wäre es nach ihm gegangen, würde ‚Hagen‘ nun eine Hand fehlen. Er
fragte sich, ob Adellinde vielleicht doch recht damit hatte, ihn zu
verschonen. Er ertappte sich dabei, wie
er sich ein ganz kleines bisschen wünschte, dass sie Unrecht behielt und er
nach der ‚Entlassung‘ keinen Tempel aufsuchen und um Vergebung bitten würde.
Denn Sieghelm meinte, dass er dann einfach zurück auf das Mythraelsfeld kehren
wird, um seiner schändlichen Tat weiter nachzugehen. Doch würden sie es wohl
nie erfahren, den ihre Queste führte sie in eine andere Richtung. Der Nebel
begann sich etwas zu lichten und die Leichen wurden weniger. Gegen späten
Nachmittag erreichten sie einen Waldesrand. Kahle, teils umgeknickte oder
zerfetzte Kiefern, Föhren und Birken standen – oder eben nicht mehr – hier
herum. Der Boden war nicht mehr ganz so aufgewühlt und der Leichengeruch ließ
langsam nach. Inzwischen hatte Hagen einen Sack so groß, dass er gebückt gehen
musste und sie alle etwas langsamer vorwärts kamen. Er keuchte und hustete,
doch schien er angetrieben vom bloßen Überlebenswillen sehr motiviert zu sein. „Lasst uns hier noch einmal umsehen“, befahl
Sieghelm in der Hoffnung, hier einen weiteren Hinweis finden zu können.
Inzwischen waren sie so weit gen Firun gelaufen, dass sie hinter den
zerfransten Baumwipfeln die Türme der Festung Auraleth sehen konnten, dem
Stammsitz des Ordens vom Bannstrahl Praios‘. „Wir müssen uns etwa zwei Meilen im Firun von Wehrheim befinden“,
merkte Sieghelm mit Blick auf die steinernen Türme an. Er fragte sich, ob die
Bannstrahler sie noch halten und ob sein Vater dort Obhut gesucht hatte.
Immerhin wäre es ein logischer Entschluss, sich hinter die sicheren Mauerringe
der Festung zurückzuziehen. Während Adellinde bei Hagen blieb, suchten Kalkarib
und Sieghelm getrennt voneinander vorsichtig die gelichteten Baumreihen nach
Hinweisen ab.
Kalkarib,
der noch immer etwas humpelte, da die Verletzung von vor zwei Nächten ihm etwas
zu schaffen machte, folgte einer aufgewühlten Spur bis hinunter zu einem
Flusslauf. Vorsichtig ließ er sich an den Bäumen den steilen Abhang hinab, um
sich am Fluss etwas zu erfrischen. Zu seiner Überraschung war das Wasser des
etwa acht Schritt breiten und flachen Flusses klar, so dass er sich sein
Gesicht damit benetzte, um den Dreck des Schlachtfelds abzuspülen. Dann
entdeckte er flussaufwärts etwas, das seine Aufmerksamkeit erhaschte. Er fand,
verheddert in den tiefhängenden Ästen einer Kiefer, eine zerfetzte Standarte.
Er erschrak kurz, als er sie sich näher betrachtete, denn sie war mit Blut
benetzt und vermeintlich menschliche Eingeweide klebten daran. Doch er erkannte
die Farben der Standarte, es waren die des Dettenhofener Siegels, wie sie
Sieghelm ihm beschrieben hatte. Für Kalkarib hieß das, dass die die Truppen von
Sieghelms Vater hier entlang gekommen sein müssen. Erfrischt vom Fluss und von
dem Wissen über die verheißungsvolle Standarte, kletterte er wieder den steilen
Abhang der Flussuferböschung hinauf. Er hielt sich an Wurzeln und Ästen fest,
um sich hochzuziehen. Als er hinter einem Baum hervorkroch und sich hochzog,
traf ihn plötzlich die Spitze eines Stiefels an der Schläfe. Er sackte
besinnungslos zurück und fiel zwei Schritt tief auf den harten,
wurzeldurchzogenen Boden der Flussuferböschung.
Teil IV – Nebel des Krieges (1)


Sieghelm Gilborn
von Spichbrecher
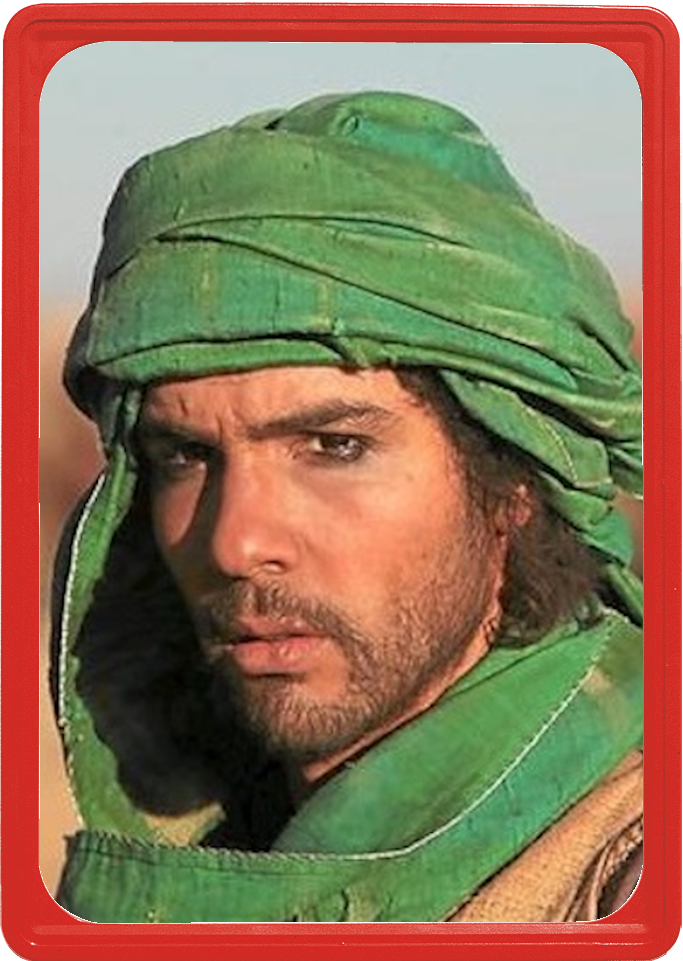
Kalkarib
al’Hashinnah

Adellinde
Peraine-Geweihte
Die Nacht
vom 17. Auf dem 18. Peraine haben Kalkarib, Adellinde und Sieghelm zusammen in
einer einsamen Scheune nahe der Reichsstraße verbracht. Schon am Abend hatte
sich Regen angekündigt und ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich einen
Unterschlupf zu suchen. Zudem wollten sie nicht in der Nacht ankommen, denn zu
viele Gefahren lauerten auf einem frischen Schlachtfeld. Briganten,
Leichenfledderer und wilde Tiere waren da noch die geringeren Übel. So kam es,
dass die Drei ihren zugigen Unterstand erst am Morgen des 18. Peraine verlassen
konnten, als es nur noch ein bisschen nieselte. Nach dem Regen folgte der
Nebel, der rund um die Scheune und auch auf das Schlachtfeld waberte und wie
schweres Tuch sich über die stille und tote Ebene legte. Die letzten Schritte
zum Mythraelsfeld legten die Drei zu Fuß zurück, ihre Pferde führten sie hinter
sich her, denn aufgrund des nassen und aufgewühlten Bodens und der geringen
Sichtweite war es nicht möglich zu Reiten.
„Ich bin als Akoluthin mal auf dem
Mythraelsfeld gewesen. Ich habe zwischen Dergel und Gernat nach Einbeeren und
Wirselkraut gesucht. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass der Boden so
aufgewühlt war“, erzählte
Adellinde, während sie immer wieder über aufgebrochene Stücken Erde hüpfen
musste. Auch Sieghelm musste über eine breite Furche hinweg steigen. „Diese Zerrüttung ist auch keineswegs
natürlich, Adellinde. Das ist das Werk des Weltenbrandes, den Galotta mit
seiner Himmelsfeste über Wehrheim entfesselte.“ Im schweren und kühlen
Nebel war die Sichtweite der Drei beschränkt. Während sich über ihnen die
Praioscheibe damit mühte durch die dichte Wolkendecke zu brechen, verhüllte der
dichte Nebel das Gräuel, welches in den letzten Tagen über das Mythraelsfeld
gekommen war. In weiter Ferne war es ihnen kaum möglich die zersplitterten
Zacken der Wehrtürme von Festung Karmaleth zu erblicken, die wie gespenstige
Zähne aus dem dichten Nebel in den ebenfalls grauen Himmel ragten. Nicht nur die
nasskalte Atmosphäre drückte die Stimmung der Drei, die bei jedem Schritt etwas
langsamer wurden, denn die nasse Erde, die nicht nur vom Regen, sondern auch
vom Blut der zahlreichen Mittelreicher durchtränkt war, blieb schwer an ihren
Stiefeln haften. Auch der unangenehm süßliche und beißende Leichengeruch hing wie
der Nebel schwer auf dem Schlachtfeld. Sie stiegen über dutzende, teilweise
übereinander liegende Leichen hinweg. Adellinde musste sich ein Tuch vor die
Nase halten, so aufdringlich war der Verwesungsgeruch. Einige der Leichen waren
verstümmelt, in grotesker Haltung liegen geblieben, gänzlich verkohlt oder so
zerfetzt, dass man nicht genau wusste, welches Körperteil genau zu sehen war.
Keinem der drei gelang es mehr die Stimme zu erheben, während sie mit immer
schwerer werdenden Schritten tiefer in das Zentrum des Schlachtfelds
vordrangen. Jeder fragte es sich, doch niemand traute es sich auszusprechen:
Sie wussten nicht genau wonach sie überhaupt suchen sollten und was ihr Ziel
war, denn durch den dichten Nebel, der sich über die Ebene gelegt hatte,
vermochten sie sich auch nicht vernünftig zu orientieren. Zwischen all den menschlichen
Leichen lagen auch immer wieder Teile Galottas schändlicher Dämonenarmee. So erblickte
sie einen kleinen Haufen geschälter Schädel, an die sich Sieghelm noch gut und
mit Schrecken erinnern konnte. Es waren rollende Anhäufungen von Schädeln, die
mittels Magie dazu gebracht wurden über ihre Gegner hinweg zu rollen und sie
dabei bis auf die Knochen abzunagen. Doch die rollenden Schädel waren nicht die
einzigen grotesken und todbringenden Abscheulichkeiten, die ihnen der
Dämonenkaiser entgegengeworfen hatte. „Sieghelm!“,
rief Kalkarib plötzlich, der mit seinem Pferd stehen geblieben war und auf den
Boden starrte. „Ist das nicht einer von
deinen Männern?“, fragte er in seinem für ihn typischen novadischen Akzent
und zeigte auf einen in den nassen und blutdurchtränkten Boden gedrückten
Körper. Sofort kam Sieghelm herüber. Bei jedem Schritt spritzte Wasser bis auf
seinem schwarzer Umhang, der inzwischen braun und steif geworden war. Trotz der
dichten Schicht aus Dreck, die darauf lag, erkannte er das Wappen des
Schutzordens der Schöpfung auf dem Wappenrock wieder. Der Mann lag auf dem
Rücken und es fehlte der Unterkörper, irgendetwas hatte ihn – anscheinend mühelos
– die Hüfte abwärts durchtrennt und seine Eingeweide lagen nun in einer dunklen
Pfütze aus Regenwasser und Blut. Während sich Regenwasser in seinem im Moment
des Todes aufgerissenen Mund sammelte, blickten seine blauen, inzwischen etwas
trüb gewordenen Augen starr gen Himmel, als würden sie gen Alveran blicken und
um Erlösung bitten. Die letzten Momente des Mannes musste er niederhöllische
Schmerzen gehabt haben. Sieghelm starrte das aschfahle Gesicht der Leiche an,
als würde er darin verzweifelt etwas suchen. Inzwischen war auch Adellinde zu
Ihnen gestoßen. Als sie den toten Körper erblickte, muss sie sich erneut ein
Tuch vor den Mund halten und kurzen Stoßgebet gen Himmel schicken. „Kennt ihr den Mann?“, frug sie durch
das Tuch mit unterdrückter Stimme. „Nein“,
antwortete er traurig. Doch in seiner Stimme lag mehr, als er verraten wollte.
Sieghelm machte sich Vorwürfe. Vorwürfe, dass er den Namen des jungen Mannes,
der sein Leben für ihn und das Mittelreich gegeben hatte, nicht kannte. Er
kannte nicht mal sein Gesicht, würde er nicht den silbernen Halbmond und den
silbernen Blutstropfen auf schwarzen Grund tragen, würde er ihn nicht mal als
einen seiner Mannen erkennen, dessen Leben zu schützen er geschworen hatte.
Adellinde
machte einen Schritt an Sieghelm heran und berührte ihn sanft am Oberarm. Sie
atmete tief ein, entfernte dann das Tuch vom Mund und sagte: „Euch trifft keine Schuld, Ser. Ihr seid
nicht für den Tod dieses Mannes verantwortlich.“ Sie wollte für ihn da
sein, ihm beistehen in seinem Moment der Unsicherheit. „Ich stimme der Priesterin zu“, gab Kalkarib als Kommentar zum Besten,
der ebenfalls sah, wie der junge Ordensmeister litt. Sieghelm blickte auf, sah
erst verständnislos zu Kalkarib und dann zu Adellinde. In ihm war eine
unbeschreibliche Leere. „Ihr versteht
nicht, worum es mir geht“, begann er im leisen Ton, hockte sich hin und
fuhr mit der Hand sanft über das Gesicht des Mannes, um seine Augen zu
schließen. „In einer Schlacht sterben
Menschen, auf jeder Seite – und dies ist nicht meine erste Schlacht. Ich war
schon Mal hier. Etwas weiter im Rahja, an der Trollpforte, kämpfte ich schon
mal gegen die Schwarzen Lande. Ich war noch ein junger Knappe als …“ Er
unterbrach sich in seiner Erzählung, als er merkte, dass dies zu weit führen
würde. Vorsichtig löste Sieghelm die Schnalle an einer ledernen Tasche der
Leiche, die aus irgendeinen Grund noch an ihr dran geblieben war. „Es geht mir darum, dass ich diesen jungen
Mann nicht erkenne.“ Adellinde und Kalkarib blickten sich kurz einander
fragend an. Ihre Blicken fragten: Meint er das ernst? Zweifelte Sieghelm etwa
an der Echtheit des Wappens? Kalkarib ergriff die Initiative: „Sieghelm, er trägt dein Wappen!“, rief
er etwas lauter als gewollt aus, als würde Lautstärke allein genügen, um ihn
zur Besinnung zu bringen. „Ja natürlich,
darum geht es mir auch nicht.“ Er fingerte aus der ledernen Gürteltasche
der Leiche einen matschigen Zettel und eine kleine Holzfigur hervor. Mit dem
Fingernagel befreite er letztere vom Schlamm, der inzwischen in die Tasche
gesickerte war. Heraus kam eine kleine Holzfigur in der Größe des kleinen
Fingers, die einen Schmied am Amboss zeigte. „Es geht mir darum, dass es nicht richtig ist. Mit Sicherheit wusste er,
wer ICH war, aber kenne ich IHN nicht und doch war er bereit sein Leben für
mich zu geben. Und das nur, weil ich ihm dazu aufrief.“ Der Gewinner der
Frühlingsturney nahm die kleine Holzfigur in seine große Hand, drückte sie fest
an sich und mit Blick zu den dichten Wolken sagte er dann mit lauter und fester
Stimme: „Ich schwöre beim Schutzorden der
Schöpfung und der donnernden Göttin, das ist das erste und letzte Mal, dass es
so sein wird. Ich Zukunft will ich jede Frau und jeden Mann der für mich kämpft
beim Namen und seiner Herkunft kennen – das schwöre ich.“ Erneut blickten
sich Adellinde und Kalkarib kurz fragend an. Langsam begannen die beiden nachzuvollziehen,
um was es dem Reichsritter ging. „Das ist
ein wahrlich hehres Ziel, Ser Sieghelm“, bekräftigte Adellinde ihn im
bewundernden Tonfall und strich ihm erneut über den Oberarm. Kalkarib hingegen
prustete, denn er hatte eine Ahnung davon, was das in Zukunft bedeuten würde.
Er sah Sieghelm schon, wie er sich jedes Mal vor der Schlacht zwanghaft unter
seine Truppen mischte und versuchte sich mit Ihnen am Lagerfeuer und bei einer
Schüssel Bohnen zu verbrüdern. Er verdrängte den aufblitzenden Gedanken jedoch,
da es jetzt wichtigeres zu tun gab. „Was
machen wir mit ihm? Wir können ihn hier unmöglich beisetzen“, erkundigte
sich der Wüstensohn. „Ich habe das hier,
das genügt. Die Zwölfe werden uns verzeihen.“ Sieghelm zeigte die kleine
Holzfigur und den schlammigen Zettel, den Sieghelm inzwischen als Brief
identifiziert hatte. „Lasst uns weiter“,
sagte Sieghelm und ging wieder zurück zu seinem Pferd, auf dem Leutnant Pagol
in Wachhaltung saß und sich stetig umsah. „Wonach
suchen wir hier eigentlich?“, warf Kalkarib ein, der den Moment des
Innehaltens nutzen wollte.Mit einem
teils fragenden und teils entsetzten Blick, drehte sich Sieghelm zu Kalkarib
um: „Nach meinem Vater, natürlich!“ „Ja,
natürlich. Aber …“ Kalkarib machte eine drehende Geste um sich herum. „ … wir können nicht gerade sehr weit sehen
in dem Nebel. Das ist wie die Suche nach einem einzelnen Sandkorn in der
Wüste.“ „Du meinst, wie die Suche nach einer Nadel in einem Heuhaufen?!“ Beide
Männer starrten sich blinzelnd und ahnungslos an. „Warum sollte man eine Nadel im Heuhaufen suchen wollen?“, platzte
es im gereizten Tonfall aus Kalkarib heraus, der genau zu wissen glaubte,
worauf Sieghelm anspielte. Es ging ihm erneut darum, seine Kultur zu
verunglimpfen und seine Mittelländer-Kultur überseine Novadi-Kultur zu stellen. „Ach und die Suche nach einem einzelnen Sandkorn in der Wüste …“
„MÄNNER!“, platzte es aus Adellinde lauthals heraus. Zu gerne hätte sienun alle ihr zur Verfügung stehenden
Finger auf die Lippen beiden Männer gelegt, doch leider standen sie zu weit
auseinander, weshalb sie auf ein anderes erzieherisches Mittel zurückgreifen
musste. Sie setzte mit nachdrücklichen Unterton, der keinen Einwand duldete,
an: „Mit Sicherheit hat Ser Sieghelm
einen gut durchdachten Plan, wie wir – trotz des dichten Nebels und des starken
Verwesungsgeruchs – seine Hochwohlgeboren Parzalon zügig finden können, ohne
ziellos über Berge aus Leichen zu stapfen. Denn niemand von uns möchte sich an
diesem gottverlassenen Ort länger als nötig aufhalten. Nicht wahr, eure
Exzellenz?“ „Ganz recht! Und natürlich habe ich einen Plan!“ Mit diesen
Worten nahm er wieder die Zügel seines Pferdes und spürte den vernichtenden
Blick der Geweihten im Nacken, weshalb er sich dazu entschied sich noch einmal
zu seinen Gefährten umzudrehen um sie in seinen ‚Plan‘ einzuweihen: „Die Dettenhofener Truppen meines Vaters
befanden sich auf der Linken Flanke, also im Firun des Mythraelsfeldes. Dort
wurden sie auch zuletzt gesehen. Es heißt, dass sie vom Zentrum abgedrängt
wurden. Unsere Suche wird also auf der Firunsseite des Schlachtfelds beginnen.“
Und als ob diese Erklärung genügte, ging Sieghelm nach einem kurzen Blick
zu den zerfallenen Türmen von Burg Karmaleth, um sich zu orientieren, wieder
voran. Als Kalkarib an Adellinde mit seinem Pferd vorbeiging, raunte er ihr noch
trotzig zu: „Wer ist so dumm und
versteckt eine Nadel im Heuhaufen?“ Was Adellinde zu dem Entschluss
brachte, den nächsten Verbandwechsel bei ihm etwas straffer zu gestalten.
Die drei
suchten sich einen möglichst halbwegs geraden Weg durch das ehemalige Schlachtfeld
gen Firun. Die Leichenberge und Verwesungsgerüche machten den Weg zu einer
Tortur. Der Magnum Opus des Weltenbrandes hatte verschiedenste unheilige Kräfte
herbeigeschworenen, die das Land nicht nur verwüstet, sondern es auch
topografisch gänzlich verändert hatten. Die Erde war an mehreren Stellen
Ellenbreit aufgerissen worden, tiefe Kratertrichter von Explosionen und
Einschlägen von herabfallenden Steinen durchzogen das Feld. Humusdämonen hatten
die Wurzeln der Erde dazu gebracht empor zu steigen und sich als Ranken um
Menschen zu schlingen. Diese zerstörten Konstrukte lagen noch immer wie
versteinerte krause Haare von Riesen in der Landschaft herum und erschwerten
das Durchqueren zusätzlich. Eine unbestimmte Zeit später liefen Sieghelm,
Kalkarib und Adellinde auf eine am Boden hockende Gestalt auf. „Seid gegrüßt“, rief Sieghelm ihr euphorisch
zu. Durch den Nebel waren sie der Person bis auf zehn Schritt nahe gekommen, da
sie sie nicht eher erblicken konnten. Als Sieghelm die kauernde Gestalt anrief,
schien sie sich zu erschrecken, fuhr hoch und wirbelte, da sie den dreien zuvor
den Rücken zugekehrt hatte, herum. „Gut
zu sehen, dass jemand überlebt hat …“, begann er, wurde jedoch von der
Gestalt unterbrochen: „Was wollt ihr? Wer
seid ihr?“ Ängstlich blickte sich der Mann mittleren Alters mit krausem
Bart mit einem Bündel vor der Brust haltend zu den Dreien um. „Ich bin Ser Sieghelm, Ordensmeister des
Schutzordens der Schöpfung und Reichsritter des Neuen Raulschens Reich – und
wer bist du?“ „Ich? Ich ähm … niemand“, stotterte er. Als der Mann sah wie
Kalkarib seine Hand auf den Knauf seines Khunchomers legte, erschreckte er sich
so stark, dass er das Bündel vor seiner Brust etwas lockerte. Zahllose
edelmetallene Ketten, Ringe und Amulette, wertvolle Insignien und
Wappenschilder purzelten heraus und platschten in den von Blut und Regen
aufgeweichten Boden. Alle vier starrten für einen kurzen Moment auf den Haufen
wertvoller Gegenstände, die der Mann soeben fallen gelassen hatte und allen war
klar, was er hier tat. Ehe Sieghelm ‚bleib stehen‘ rufen konnte, war er auch
schon auf dem Absatz herumgewirbelt und suchte im schützenden Nebel das Weite.
Sieghelm wusste, dass er in seiner Gestechrüstung und in diesem Schlamm nicht
die geringste Chance hatte, dem Mann zu folgen. Kalkarib hingegen war flink und
leichtfüßig und trug keine erschwerende Rüstung. Ein Blick zu ihm genügte und
der durchnässte Wüstensohn flitzte über die Ebene dem Leichenfledderer
hinterher. Auch der Leutnant hüpfte vom Pferd und schoss wie eine Wurst, die
über nasse Steine rutschte, über die feuchte Erde hinweg – nur das diese dabei protestierend
kläffte.
Wenig später
brachte Kalkarib den zeternden und jammernden Leichenfledderer am Schlafittchen
gepackt zurück zu Sieghelms und Adellindes Position, die sich inzwischen die
Wertgegenstände, die er verloren hatte, etwas näher angesehen hatten. Den
ganzen Weg hatte sich Pagol in den Stiefel des Mannes verbissen und knurrte die
ganze Zeit über, als würde er sagen wollen: ‚Ich schaffe es alleine ihn zu
ziehen, lass ihn los!‘ Kalkarib warf ihn Sieghelm vor die Füße, wobei sich sein
dichter ungepflegter Bart in einer blutigen Pfütze tunkte. „Auf die Knie mit dir“, befahl
er dem Mann im rauen Ton, während Adellinde wie eine ihn legitimierende
Geweihte neben ihm stand und den Mann verurteilend ansah. „Du wirst uns jetzt dahin bringen, wo du das gefunden hast“, sagte
er und hielt dem Mann ein etwas Faustgroßes versilbertes Wappenschild von einer
Rüstung vor die Nase, das er im Haufen der Gegenstände, den der
Leichenfledderer verloren hatte, gefunden hatte.




Neueste Kommentare